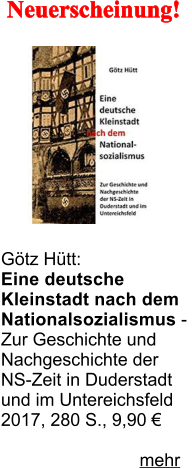Archiv 2012
•
Dornieden, ein Nazi in der Bildergalerie früherer
Bürgermeister der Stadt Duderstadt im Stadthaus
(Pressemitteilung vom 8.12.2012)
•
Gegen die Entschuldung von Nazi-Bürgermeister
Dornieden (Brief an Bürgermeister Nolte vom 6.12.2012)
•
Veranstaltungsreihe zur Gründung der neuzeitlichen
jüdischen Gemeinde in Duderstadt vor 200 Jahren im
Herbst 1812
Dornieden, ein Nazi in der Bildergalerie früherer
Bürgermeister der Stadt Duderstadt im Stadthaus
Hierbei geht es um Verharmlosung der nationalsozialistischen
Vergangenheit von Duderstadt, wie der nachfolgend
wiedergegebenen Pressemitteilung vom 8.12.2012 zu
entnehmen ist. - Vom “Eichsfelder Tageblatt” wurde der
Vorschlag nicht beachtet, die Stadt Duderstadt hat aber
inzwischen seine Prüfung zugesagt. Die Pressemitteilung
lautet:
“Bis vor wenigen Monaten noch durften über einer Eingangstür
des früheren Duderstädter Bahnhofs Überbleibsel national-
sozialistischer Kriegspropaganda prangen, vier Worte aus dem
Spruch ‘Räder müssen rollen für den Sieg!’
Unangemessener Umgang mit der NS-Vergangenheit ist auch
anderswo in der Stadt noch zu finden. Die Geschichtswerkstatt
Duderstadt hat sich vorgenommen, auf solche Fälle nach und
nach aufmerksam zu machen. Sie hat dies begonnen mit dem
Hinweis auf die gesetzwidrige, nämlich gegen das
Kriegsgräbergesetz verstoßende und unwürdige Gestaltung
von Kriegsgräbern auf dem St.-Paulus-Friedhof, wovon jedoch
nicht die Gräber der toten deutschen Soldaten, wohl aber mehr
als 100 Gräber von ausländischen Zwangsarbeitenden
betroffen sind. Trotz Zusagen hat die Stadt bis jetzt noch keine
wesentliche Verbesserung herbeigeführt.
Dem unangemessenen Umgang mit der Erinnerung an die NS-
Zeit, ihrer Opfer und Täter ist ein neuer Fall einzureihen.
Die Geschichtswerkstatt weist hin auf die Art, wie das Bild des
ehemaligen Nazi-Bürgermeisters Andreas Dornieden in einer
Bildergalerie im Stadthaus verwendet wird. Dort hängt sein
Porträt zwischen den Bildern der früheren Bürgermeister von
Duderstadt, als sei er ehrenwert wie die anderen. Die
Geschichtswerkstatt hat sich deshalb mit einem Vorschlag an
Bürgermeister Nolte und die Vorsitzenden der Ratsfraktionen
gewandt. Näheres ist dem nachstehenden Brief zu entnehmen.”
Gegen die Entschuldung von Nazi-Bürgermeister
Dornieden (Brief an Bürgermeister Nolte vom 6.12.2012)
An die
Stadt Duderstadt
z. Hd. des Herrn Bürgermeisters
und der Vorsitzenden der Fraktionen im Rat der Stadt
Duderstadt
Bild von Andreas Dornieden in der Galerie der Fotos
ehemaliger Bürgermeister von Duderstadt
Sehr geehrte Frau Jung, sehr geehrte Herren!
Nach dem Tod von Andreas Dornieden, des Nazi-
Bürgermeisters von Duderstadt, veröffentlichten Bürgermeister
Willi Thiele und Stadtdirektor Karl Krukenberg 1976 einen
Nachruf, in dem es hieß: „Der Verstorbene war von 1933 bis
1945 Bürgermeister der Stadt Duderstadt. Während dieser Zeit
hat er seine ganze Arbeitskraft dem Wohle unserer Stadt
gewidmet. Dafür sei ihm herzlich Dank gesagt. Wir werden ihm
ein ehrendes Gedenken bewahren.“ – Letzteres geschieht auch
heute noch im Duderstädter Stadthaus. Dort hängt sein Bild
unter den Bildern der früheren Bürgermeister von Duderstadt,
als sei er ehrenwert wie die anderen.
Der 30. Januar 2013 ist der 80. Jahrestag der
„Machtergreifung“ der Nationalsozialisten im damaligen
Deutschen Reich. Im Untereichsfeld war Andreas Dornieden
1933 der führende Totengräber der Demokratie. Zwar war er
praktizierender Katholik, aber zugleich der ranghöchste
Nationalsozialist im Kreis Duderstadt. Als solcher propagierte
und förderte er die Ziele der NSDAP. Im Amt des
Bürgermeisters wirkte er mit an der Unterdrückung der Juden in
Duderstadt, sorgte er für einen „geordneten“ Ablauf des
Pogroms am 9./10. November 1938 im Sinne seiner Urheber
und war mitverantwortlich für Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, nämlich für die Organisation von Zwangsarbeit
in Duderstadt und die Deportation der letzten jüdischen
Einwohner der Stadt. In der Nachkriegszeit nannte er, offenbar
unbelehrt, das Handeln der sehr wenigen Duderstädter, welche
die amerikanischen Truppen als Befreier begrüßt hatten,
„Szenen einer würdelosen Anbiederung“.
Der Nachruf von 1976 bedeutete die vollkommene
Freisprechung des Nazi-Bürgermeisters von aller Schuld.
Gleiches geschieht durch die unterschiedslose Aufnahme des
Bildes von Andreas Dornieden in die Bürgermeister-
Fotogalerie. So, durch die Entschuldung des wohl
prominentesten Nationalsozialisten im Untereichsfeld, wird
unter anderem fälschlich suggeriert, Nationalsozialismus habe
in Duderstadt eigentlich nicht stattgefunden. Das kann dazu
verleiten, die weiterhin notwendige Auseinandersetzung mit der
NS-Zeit für überflüssig zu halten und sich ihr zu entziehen.
Wir schlagen vor, anlässlich des 30. Januar 2013 dem Foto von
Andreas Dornieden eine Darstellung seines Wirkens als
nationalsozialistischer Bürgermeister aus demokratischer und
rechtsstaatlicher Perspektive beizufügen. Das könnte zugleich
ein erster Schritt sein, um auch die anderen Bilder der
Bürgermeister-Galerie nach und nach durch eine Erläuterung
des Wirkens der jeweiligen Amtsträger zu ergänzen.
Für die Geschichtswerkstatt Duderstadt e. V.
gez. Götz Hütt
Veranstaltungsreihe zur Gründung der neuzeitlichen
jüdischen Gemeinde in Duderstadt vor 200 Jahren im
Herbst 1812
Duderstadt hat auch eine jüdische
Geschichte. Vor genau zwei
Jahrhunderten, im Herbst 1812, wurde
durch den Zuzug von fünf jüdischen
Familien die neuzeitliche jüdische
Gemeinde in Duderstadt gegründet.
Sie bestand 130 Jahre. In Duderstadt
hat sich bereits vor mehr als einem
Jahr auf einen Vorschlag der
Geschichtswerkstatt Duderstadt hin ein
Runder Tisch gebildet mit dem Ziel, an
dieses bedeutsame Ereignis in der
Stadtgeschichte vor zweihundert
Jahren zu erinnern. Am Runden Tisch
haben sich Vertreter der
Kreisvolkshochschule Göttingen, der Kirchengemeinde St.
Cyriakus, der Stadt Duderstadt, des Eichsfeld-Gymnasiums,
des SPD-Ortsvereins Duderstadt, von Bündnis 90/Die Grünen –
OV Unteres Eichsfeld sowie der Geschichtswerkstatt
Duderstadt beteiligt.
Freitag, der 14.9.2012:
Denn alles wird gut!
Götz Hütt und drei Musiker aus Duderstadt und Göttingen
haben am vergangenen Freitag einen stimmungsvollen und
bewegenden
Abend im Duderstädter Rathaus gestaltet mit jüdischer Musik,
Liedern aus Theresienstadt und einer Lesung über die
Geschichte der neuzeitlichen jüdischen Gemeinde in
Duderstadt.
Der Runde Tisch und die Geschichtswerkstatt Duderstadt
hatten anlässlich der Gründung der jüdischen Gemeinde
Duderstadt vor 200 Jahren zu einem kleinen Konzert mit
Lesung in den Bürgersaal des Duderstädter Rathauses
eingeladen. Bürgermeister Nolte begrüßte die rund 30
Besucher und dankte allen, die diese außerordentliche
Begegnung ermöglicht hatten. Im Namen des Stadtrates
begrüßte er es ausdrücklich, dass der neuzeitlichen Geschichte
der Jüdischen Gemeinde in Duderstadt gedacht werde, aber
auch der Leiden und Schwierigkeiten, denen Juden in dieser
Zeit ausgesetzt waren. Die Stadt Duderstadt stehe voll und
ganz hinter dieser Aufgabe. Im Namen des Runden Tisches
und der Geschichtswerkstatt begrüßte auch Brita Bunke-
Wucherpfennig die Anwesenden. Sie dankte der Stadt dafür,
dass dieser Abend im Rathaussaal stattfinden konnte, der ja
gerade für die jüdische Geschichte der Stadt ein besonders
authentischer Ort sei.
Die Musiker aus Duderstadt und Göttingen, Svetlana Smertin,
Gesang, Karsten Heckhausen, Violoncello, und Beate Quaas,
Klavier, hatten Stücke ausgewählt, die eine große Bandbreite
jüdischer Musik der letzten zwei Jahrhunderte wiedergaben:
„From Jewish Life" (1924) von Ernest Bloch, „Kol Nidrei" op. 47
(1880) von Max Bruch und Lieder aus „Sechs israelische
Melodien" (1979) von Joachim Stutschewsky. Karsten
Heckhausen und Beate Quaas spielten die drei Werke
eindrucksvoll mit großem Einfühlungsvermögen, mit viel
Intensität und expressivem Ausdruck.
Zwischen diese Stücke für Violoncello und Klavier hatten die
Musiker Lieder ins Programm gesetzt, die sie für ihre
Besetzung bearbeitet hatten. Svetlana Smertin sang den
Liederzyklus „Ich wandre durch Theresienstadt" von Ilse Weber,
die 1944 in Auschwitz ermordet wurde. Ilse Weber, eine
tschechische Schriftstellerin, schrieb schon als junges Mädchen
jüdische Kindermärchen und kleine Theaterstücke für Kinder.
1942 wurde sie von Prag in das KZ Theresienstadt deportiert.
Von ihren Gedichten wurde besonders das Lied „Ich wandre
durch Theresienstadt" berühmt, das sie für ihren Sohn
aufgeschrieben hat, den sie vor Ausbruch des Krieges in Prag
in einen Zug nach England gesetzt hatte und den sie eines
Tages wiederzusehen hoffte. In dem Liederzyklus wechseln
sich Wiegenlieder mit Liedern ab, die von der starken Hoffnung
getragen sind, dass der Aufenthalt im Lager irgendwann ein
Ende haben werde. Die Lieder aus Theresienstadt, mit ihren
einfachen kompositorischen Sätzen und anrührenden Texten,
wurden von den Musikern schlicht und unpathetisch, aber warm
und intensiv vorgetragen. Besonders die Sängerin erreichte mit
ihrer natürlichen und klangschönen Stimme unmittelbar die
Zuhörer. Das war einer der bewegendsten Momente des
Abends. In einem zweiten Liedblock brachten die Musiker drei
Liebeslieder aus einer Sammlung jiddischer Lieder von
Francois Lilienfeld zu Gehör. Auch hier gelang es ihnen, die
Fröhlichkeit und zugleich Schwermut dieser Lieder an die
Zuhörer weiterzugeben.
Zwischen den Musikstücken las Götz Hütt aus seinem neu
erschienenen Buch „Geschichte der neuzeitlichen jüdischen
Gemeinde in Duderstadt". Das waren ungemein spannende
Beiträge. Er vermittelte, dass Duderstadt, zu dessen
Bevölkerung im 14. bis 16 Jahrhundert immerhin noch bis zu 12
jüdische Familien zählten, Anfang des 19. Jahrhunderts keine
jüdischen Einwohner hatte. Erst die französische Revolution
und die vorübergehende Zugehörigkeit Duderstadts zum
Königreich Westfalen unter Napoleons Bruder Jérôme
Bonaparte sicherte Juden dasselbe Recht zu wie allen anderen
Untertanen. So stellte 1811 ein Jude aus Wöllmarshausen den
Antrag, mit seiner Familie und der seines Bruders in Duderstadt
leben zu dürfen. Über diesen Antrag wurde im Rathaus
verhandelt. Allerdings hatte der Bürgermeister Einwände und
Bedenken und musste erst von übergeordneter Stelle zur
Rechtslage belehrt werden. So dauerte es ein gutes Jahr, bis
am 6. Oktober 1812, also vor 200 Jahren, Calman Eichholz
seinen neuen Wohnsitz in Duderstadt anmelden konnte.
Hütt machte deutlich, dass Judenhass und Judenfeindlichkeit
keineswegs Merkmale ausschließlich der NS-Zeit waren,
sondern in der gesamten Geschichte der jüdischen Gemeinde
in Duderstadt wiederzufinden sind. Schon 1816 gab es
Bestrebungen, die Juden wieder aus der Stadt zu verweisen.
Auch in zahlreichen anderen Entscheidungen städtischer
Gremien, der Zuweisung einer Viehweide als Begräbnisplatz,
Einwendungen gegen den Bau einer Synagoge, und der
fehlenden Bereitschaft, jüdische Schülerinnen und Schüler an
den konfessionellen städtischen Schulen aufzunehmen, zeigte
sich eine tief verwurzelte Ablehnung der jüdischen Mitbürger.
Allerdings wurde der Antisemitismus nie so öffentlich und so
todbringend betrieben wie in der NS-Zeit. Umso berührender ist
daher der Liedtext, den Ilse Werner im KZ Theresienstadt
geschrieben hat, mit dem die Musiker den Abend beendeten:
„Denn alles wird gut, ertrag geduldig das Warten, vertrau
derZukunft, verlier nicht den Mut, die Welt wird wieder zum
Garten!"
Christoph Nothdurft
● Sonnabend, der 6.10.2012:
Die Stimme der Synagoge - Konzert mit Andor Izsák
Feier zur Erinnerung an die Gründung der jüdischen Gemeinde
im Jahr 1812 mit einem Konzert von Prof. Andor Izsák,
dem Leiter des Europäischen Zentrums für Jüdische Musik,
Hannover. Zeit und Ort: 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses
Duderstadt – eine Veranstaltung des Runden Tisches und der
Stadt Duderstadt Zur Erinnerung an den Zuzug der ersten
jüdischen Familien am 6.10.1812 nach Duderstadt fand am
6.10.2012 im Bürgersaal des Duderstädter Rathauses in
Zusammenarbeit mit der Stadt Duderstadt eine
Gedenkveranstaltung des Runden Tisches statt. Prof. Andor
Izsák spielte und erläuterte jüdische synagogale Musik und bot
damit die Gelegenheit, sich mit den früheren jüdischen
Einwohnern im Geiste zu verbinden. Im Rahmen dieser
Veranstaltung überreichte Bürgermeister Nolte einen Ehrenbrief
für Rolf Ballin, den letzten noch lebenden jüdischen Einwohner
der Stadt, an dessen Tochter und Enkeltochter, die aus Israel
angereist waren.
● Sonnabend, der 13.10.2012
Stadtrundgang
zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Duderstadt
Führung: Götz Hütt, Geschichtswerkstatt Duderstadt
Zeit und Ort: Beginn um 15 Uhr beim Wallaufgang
Obertorstraße. Eine Veranstaltung des Runden Tisches und
der Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V.
● Mittwoch, der 7.11.2012
Von Symmetrien und Asymmetrien.
Über das Verhältnis von Christentum und Judentum,
mit Dr. Fornet-Ponse
Zeit und Ort: 19 Uhr in der Kreisvolkshochschule in Duderstadt
– eine Veranstaltung des Runden Tisches und der St.-Cyriakus-
Kirchengemeinde
Stadtrat und Geschichte
Gedenkfeier am 27. Januar 2012 ist unvereinbar mit
Verharmlosung von Konzentrationslagern durch hohen
Repräsentanten der Stadt Duderstadt
Die Geschichtswerkstatt Duderstadt kritisiert die Durchführung der
Gedenkfeier der Stadt für die Opfer des Nationalsozialismus am 27.
Januar 2012 scharf: Die Stadt Duderstadt hat die das Leiden in den
nationalsozialistischen Konzentrationslagern in krasser Weise
verharmlosenden Äußerungen des hohen Repräsentanten der Stadt
Lothar Koch geduldet und keinerlei Distanzierung erkennen lassen.
Koch, u.a. Ratsmitglied, Ehrenbürgermeister der Stadt Duderstadt,
stellvertretender Landrat des Landkreises Göttingen, niedersächsischer
Landtagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des
Kultusausschusses, hatte in einer Ratssitzung am 12. Dezember 2011
auf Kritik an seinen fortgesetzten Zwischenrufen mit dem Ausruf
reagiert: "Ich bin doch hier nicht im KZ!" und in einer kurzen Erklärung
erläutert: "KZ steht für mich für nicht vorhandene Gedanken- und
Redefreiheit."
Ein Leserbrief des Vorsitzenden der Geschichtswerkstatt Duderstadt,
Götz Hütt, an das Eichsfelder Tageblatt wurde von diesem nicht
abgedruckt. Hier der Wortlaut:
Verharmlosung der Konzentrationslager
Das kann nur den braunen Bodensatz in unserer Gesellschaft stärken:
"Ich bin doch hier nicht im KZ", bemerkte Lothar Koch im Duderstädter
Stadtrat, als ein Redner der Opposition sich gegen störende
Zwischenrufe des stellvertretenden Ratsvorsitzenden und
Landtagsabgeordneten zur Wehr setzte. Koch sagte weiter: "KZ steht für
mich für nicht vorhandene Gedanken- und Redefreiheit." Für die
Häftlinge dagegen bedeuteten die Konzentrationslager noch ganz
anderes: Entwürdigung, Hunger, körperliche Gewalt, Massenmord. Die
Äußerungen von Lothar Koch verharmlosen also das KZ-System auf
unerträgliche Weise. Der CDU-Politiker kann sich deshalb nicht einfach
mit der Floskel "völlig unangemessen" aus der Affäre ziehen wollen,
sondern muss seine Äußerungen inhaltlich begründet zurücknehmen,
will er sein durch ihn selbst beschädigtes Ansehen als Volksvertreter im
demokratischen Rechtsstaat wiederherstellen.
Eine Pressemitteilung der Geschichtswerkstatt wurde ebenfalls der
Öffentlichkeit vorenthalten. Ihr Inhalt:
Mit Empörung wurde in der Jahreshaupt-versammlung der
Geschichtswerkstatt Duderstadt aufgenommen, dass der stell-
vertretende Bürgermeister Koch (MdL) in der letzten Stadtratssitzung
Konzentrationslager verharmloste und der Ratsvorsitzende Vollmer
dagegen nicht einschritt. Dieser Vorgang muss nach Ansicht der
Geschichtswerkstatt unverzüglich bereinigt werden, zumal er die
Glaubwürdigkeit der Gedenkfeier der Stadt am 27.1.2012 für die Opfer
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Frage stellt.
Die Mitglieder des Vereins Geschichtswerkstatt beanstandeten, dass
Lothar Koch in der Ratssitzung zahlreiche eigene Zwischenrufe mit den
Bemerkungen „Ich bin doch hier nicht im KZ" und „KZ steht für mich für
nicht vorhandene Gedanken- und Redefreiheit" verteidigt hatte. Solche
Äußerungen bedeuteten eine gestörte Geschichtswahrnehmung.
Schließlich hätten die Häftlinge der Konzentrationslager Freiheits-
beraubung, Entwürdigung, Hunger, körperliche Gewalt und Tod erleiden
müssen. Kritisiert wurde auch der Ratsvorsitzende Vollmer, weil er die
Äußerungen von Koch nicht gerügt hatte. Beide Repräsentanten der
Stadt wird die Geschichtswerkstatt brieflich dazu auffordern, ihr
Verhalten unverzüglich zu revidieren. Solange im Stadtrat
Konzentrationslager verharmlost würden, könne die Stadt am 27.1.2012
der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nicht glaubwürdig
gedenken. Beides passe nicht zusammen.
Die beiden floskelhaften Worte „völlig unangemessen" des
stellvertretenden Bürgermeisters Koch am nächsten Tag gegenüber der
Presse, so die Versammlung, reichten nicht, um die Affäre zu
bereinigen. Vielmehr müsse Koch, nachdem er den demokratischen
Konsens in Frage gestellt habe, sein Missverständnis von
Konzentrationslagern inhaltlich und öffentlich bereinigen. Der
Ratsvorsitzende Vollmer wird sein Verhalten erklären und darlegen
müssen, wie er künftig eventuelle Verharmlosungen des
Nationalsozialismus im Stadtrat unterbinden werde. Die
Geschichtswerkstatt wird beide Politiker deswegen anschreiben.
Um den Standpunkt der Geschichtswerkstatt Duderstadt an die
interessierte Öffentlichkeit zu bringen, wollten die Mitglieder als letztes
Mittel in die Ausgabe des Eichsfelder Tageblatts vom 27.1.2012 eine
Anzeige mit folgendem Text setzen:
Die Verharmlosung von Konzentrationslagern im Stadtrat durch Lothar
Koch, gebilligt durch das Schweigen einer großen Mehrheit, ist
unvereinbar mit der heutigen Gedenkfeier der Stadt für die Opfer des
Nationalsozialismus und muss inhaltlich zurückgenommen werden.
Geschichtswerkstatt Duderstadt
Das Eichsfelder Tageblatt verweigerte jedoch die Annahme dieser
Anzeige mit der Begründung, das Tageblatt sei überparteilich, die
Anzeige aber "meinungsbildend". Die Frage, warum das Tageblatt
meinungsbildende Anzeigen politischer Parteien durchaus
veröffentliche, die unseres Vereins aber nicht, wurde mit Schweigen
beantwortet.



Themen:
NS-Zwangsarbeit
- Zwangsarbeiterkind
in Duderstadt
KZ-Außenlager
Jüdische Gemeinde:
- Geschichte
- jüdischer Friedhof
- Friedhof 1953
- Vernichtung
- Stolpersteine
Nationalsozialismus
und Duderstadt
- Verdrängte Realität
- Bgm. Dornieden
- Richter Trümper
- Priester R. Kleine
Nachgeschichte des
Nationalsozialismus:
- bürgerliche Alt-Nazis
- Kriegsgräber
- Anreischke
- Rechtsextremismus
Friedensglobus
Kriegsgefangene
Hinweis:
Die
Geschichtswerkstatt
Duderstadt e.V.
wurde vom
Finanzamt Northeim
als gemeinnützig
anerkannt und kann
Spendenquittungen
ausstellen.
Bankverbindung der
Geschichtswerkstatt:
Sparkasse
Duderstadt (BLZ
26051260), Konto
Nummer 116830