




Themen:
NS-Zwangsarbeit
- Zwangsarbeiterkind
in Duderstadt
KZ-Außenlager
Jüdische Gemeinde:
- Geschichte
- jüdischer Friedhof
- Friedhof 1953
- Vernichtung
- Stolpersteine
Nationalsozialismus
und Duderstadt
- Verdrängte Realität
- Bgm. Dornieden
- Richter Trümper
- Priester R. Kleine
Nachgeschichte des
Nationalsozialismus:
- bürgerliche Alt-Nazis
- Kriegsgräber
- Anreischke
- Rechtsextremismus
Friedensglobus
Kriegsgefangene
Hinweis:
Die
Geschichtswerkstatt
Duderstadt e.V.
wurde vom
Finanzamt Northeim
als gemeinnützig
anerkannt und kann
Spendenquittungen
ausstellen.
Bankverbindung der
Geschichtswerkstatt:
Sparkasse
Duderstadt (BLZ
26051260), Konto
Nummer 116830

Ausstellung:
Auf der Spur
europäischer
Zwangsarbeit -
Südniedersachsen
1939-1945
Öffnungszeiten:
wegen Wasserschaden
leider bis Ende des
Jahres geschlossen
mittwochs und freitags
von 10-16 Uhr,
jeden 1. Sonntag
im Monat von
14-17 Uhr
Tel. 0551/29 34 69 01
Mehr Informationen:
www.zwangsarbeit-in-
Niedersachsen.eu
BBS II
Godehardstr. 11
37081 Göttingen
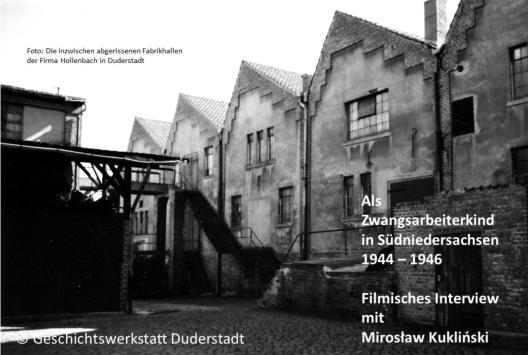
Mirosław Kukliński:
Als Zwangs-
arbeiterkind
in Südniedersachsen
1944-1946.
Filmisches Interview.
Für 5 € erhältlich
bei der
Geschichtswerkstatt
Duderstadt.
DVD:









Als Zwangsarbeiterkind in Südniedersachsen  1944-1946
1944-1946 Während des Zweiten Weltkrieges wurden Millionen zur
Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert – laut Nürnberger
Prozess ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Interview
mit Mirosław Kukliński zeigt, wie auch Kinder zu den Opfern
zählten.
Der vierjährige Mirosław erlebte Kämpfe während des
Warschauer Aufstandes und wurde mit seinen Eltern über das
Durchgangslager Pruszków in das KZ Sachsenhausen deportiert,
dann mit seiner Mutter weiter in das KZ Buchenwald und ins
Untereichsfeld. Teils aus den Erzählungen der Mutter, teils aus
eigener Erinnerung berichtet Mirosław Kukliński über ihr
Schicksal in der Ziegelei Jacobi in Bilshausen und in der
Reißwollfabrik Hollenbach in Duderstadt. Es ist ein subjektives
Erinnern an die Zeit als Zwangsarbeiterkind in Duderstadt, die
Befreiung durch Truppen der USA, das Schicksal als Displaced
Persons und das Wiederfinden des Vaters in Warschau. Mirosław
Kukliński erzählt, wie sein eigenes Leben nach dem Krieg
beeinflusst war durch eine Liebe zu den USA, die sich in
Duderstadt in der Begegnung mit den amerikanischen Befreiern
entwickelt hatte.
Die Darstellung unterschiedlicher Behandlung von zwei Gruppen
polnischer Zwangsarbeitenden in dem Interview konnte nicht
verifiziert werden. Allerdings: Während Zwangsarbeitende
üblicherweise durch das Arbeitsamt vermittelt wurden, kam die
Warschauer Gruppe aus dem KZ der SS.
Die DVD enthält das Interview mit Mirosław Kukliński in drei
Teilen:
Teil 1: Von Warschau ins Eichsfeld – 1944
Teil 2: Zwangsarbeit bei der Firma Hollenbach in Duderstadt –
1944/45
Teil 3: Befreiung und Rückkehr nach Warschau
Der Film wurde mit Unterstützung der Stiftung niedersächsische
Gedenkstätten und aus dem Projekt „Moving with the Exhibition“
der Geschichtswerkstatt Göttingen gefördert. Die eingeblendeten
Fotos stammen aus dem Bundesarchiv und von Mirosław
Kukliński. Interview: Götz Hütt. Kamera und Schnitt: Sascha
Heppe.
Günther Siedbürger: Einführung ins Thema NS-
Zwangsarbeit in Stadt und Altkreis Duderstadt
Etwa 13,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte und Häftlinge von
Konzentrationslagern und ähnlichen Haftstätten verrichteten
zwischen 1939 und 1945 Zwangsarbeit auf dem Gebiet des
„Großdeutschen Reichs“. Davon waren etwa 8,4 Millionen – also
der weitaus größte Teil – Zivilarbeiter, 1,7 Millionen Häftlinge aus
Konzentrationslagern, Ghettos und ähnlichen Lagern und etwa 3,4
Millionen Kriegsgefangene.
Alle drei Gruppen waren hier in Duderstadt vertreten:
Kriegsgefangene mit Arbeitskommandos in Industrie,
Landwirtschaft und einzelnen Handwerksbetrieben;
Ein Außenkommando des KZ Buchenwald mit 750 bzw. 755
jüdischen Frauen, die fast ausschließlich aus Ungarn kamen, in
der Rüstungsfabrik Poltewerke am Euzenberg;
Ausländische zivile Zwangsarbeitende praktisch überall: neben
der Landwirtschaft, in der in der Region knapp die Hälfte der
Zwangsarbeitenden eingesetzt wurde, arbeiteten sie in der
Industrie, bei der Eisenbahn, in Handel, Handwerk,
Gesundheitseinrichtungen wie dem Martini-Krankenhaus, in
der Forstwirtschaft und in kommunalen Betrieben.
Vor 30 Jahren war über Art und Umfang dieses
Kriegsverbrechens hier fast gar nichts bekannt. Das hat sich
mittlerweile zumindest für die Gruppen der KZ-Häftlinge und der
Zivilarbeiter geändert, während wir über die Situation der hier
eingesetzten Kriegsgefangenen nach wie vor nicht viel wissen.
Ausländische zivile Zwangsarbeitende prägten das tägliche Bild in
den Städten und Dörfern. Ihr Altersspektrum reichte von kleinen
Kindern bis zu Greisen, die alle zur Arbeit gezwungen wurden.
Ohne ihren Einsatz wäre die deutsche Wirtschaft
zusammengebrochen. Viele deutsche Betriebe haben von dem
Einsatz ausländischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wirtschaftlich profitiert.
Zivilarbeiterinnen und -arbeiter kamen aus einer Vielzahl von
Staaten und Nationen; für Südniedersachsen sind bisher 16
Herkunftsländer nachgewiesen. Fast zwei Drittel (61 %) kamen
aus Osteuropa. Die mit Abstand größte einzelne Gruppe (42 %)
stellten dabei die Bewohner Polens dar. Knapp zwei Drittel der
Zwangsarbeitenden in der Region waren männlichen
Geschlechts.
In ihrer Heimat wurden die Menschen als Arbeitskräfte
angeworben, „dienstverpflichtet“ oder – wie sehr häufig –
gewalttätig von der Straße weg deportiert. Unabhängig davon
einte sie, dass sie, einmal im Reich, nicht mehr in ihre Heimat
zurückkehren konnten, sondern praktisch Gefangene waren.
Dieser sogenannte Ausländereinsatz im Reich war ideologisch
eigentlich nicht erwünscht. Die nationalsozialistische
Rasseideologie nahm Abstufungen zwischen Angehörigen
„arischer“ Völker, zu denen z.B. Niederländer bzw. „Flamen“
zählten, „romanischer“ Völker (z.B. Franzosen und „Wallonen“)
und„slawischer“ Völker (z.B. Polen, Russen) vor. Die aus Polen
und der Sowjetunion deportierten Menschen galten als Slawen
und damit als Untermenschen. Ihr Stellenwert war der von
Arbeitstieren für die deutsche/ arische Herrenrasse. Für diese
Gruppe wurde ein Sonderstrafrecht eingeführt, das die
Lebensführung bis ins kleinste festlegte. Die Details ihres
Alltagslebens waren bis hin zum Friseurbesuch oder zum
Kirchgang reguliert und strafbewehrt. Insgesamt liefen diese
Regelungen auf eine möglichst weitgehende Beschränkung der
Bewegungsfreiheit, eine umfassende Isolierung und die
Herabstufung zum rechtlosen Objekt nationalsozialistischen
Herrschaftswillens hinaus. Merkblätter für die deutschen
Arbeitgeber und zahlreiche Hetzartikel in der Tagespresse sorgten
dafür, dass die einheimische Bevölkerung über diese Regelungen
genau (teilweise besser als die Betroffenen selbst) im Bilde war.
Die Betroffenen selbst schwebten in ständiger Gefahr, wegen
irgendwelcher Kleinigkeiten oder aufgrund von Denunziationen
verhaftet, ins Gefängnis oder Straflager gesteckt zu werden und
infolge dessen womöglich ihr Leben zu verlieren.
Mit dem Sonderstrafrecht für Polen wurde 1940 auch erstmals die
„Kennzeichenpflicht“ für eine Personengruppe im Reich
eingeführt. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wurden gezwungen, an ihrer Kleidung ständig ein „P“-Abzeichen
zu tragen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der
Verschleppung vieler dortiger Bewohner ins Reich wurde eine
entsprechende Regelung auch für diese Menschen geschaffen:
als sogenannte Ostarbeiter waren sie gezwungen, ein Abzeichen
mit dem Wort „OST“ an ihrer Kleidung zu tragen.
Hier in Stadt und Altkreis Duderstadt spielte die Industrie als
Einsatzort von Zwangsarbeitenden eine große Rolle. Vor
Kriegsbeginn herrschte hier eine sehr stark landwirtschaftlich
orientierte Wirtschafts- und Sozialstruktur vor. Das änderte sich im
Krieg rasant. Zwischen 1939 und 1944 wuchs die Zahl der
Einwohner der Stadt Duderstadt um 71 Prozent. An dieser
Steigerung hatten die vielen ausländischen Arbeitskräfte, die in
die Stadt gekommen bzw. dorthin verbracht worden waren,
großen Anteil. Sie arbeiteten in den lokalen Industriebetrieben und
in der Bauwirtschaft, der bei weitem größte Teil von ihnen in der
Stadt selbst bei Bau und Betrieb des Rüstungsunternehmens
Polte, im Kreis auf der Großbaustelle des chemischen Betriebes
Schickertwerke in Rhumspringe.
In dem Film spielen zwei andere Firmen eine Rolle. Da sind zum
einen die Jacobi Tonwerke mit ihrem Stammwerk in Bilshausen.
Hier arbeiteten während des Krieges ca. 220 Ausländer, sämtlich
aus Osteuropa, der größte Teil aus der Sowjetunion stammend, in
der Ziegelproduktion und bei Verladearbeiten. Fast
die Hälfte waren Frauen, es gab relativ viele Ehe- und
Geschwisterpaare, z. T. offenbar ganze Familien. Für diese
osteuropäischen Zwangsarbeitenden führte der Betrieb ein
eigenes Lager in vier festen Gebäuden innerhalb des
eingezäunten Fabrikgeländes, das sogenannte „Russenlager“,
das von einem deutschen „Betriebsobmann“ überwacht wurde.
Im Sommer 1944 häuften sich die hygienischen Missstände in
diesem Lager. Die Ungezieferplage, die ihre Ursache in
mangelhaften hygienischen Verhältnissen, unzureichender
Kleidung und wohl auch Überfüllung der Unterkünfte hatte, nahm
immer stärker zu. Da die einzige Entlausungsanlage im Altkreis
sich im 18 km entfernten Duderstädter Krankenhaus befand,
drängte die Firma beim Landrat auf die Aufstellung eines
zusätzlichen Entlausungsapparates direkt auf dem
Firmengelände.
Mindestens zwei Arbeiter aus der Sowjetunion, die bei Jacobi in
Bilshausen Zwangsarbeit leisten mussten, Grigory Popow und
Dmitry Pilipinko, starben 1943 bzw. 1944 an Lungentuberkulose.
1943 starb zudem im „Wohnlager Jakobi“ ein sowjetisches Kind
im Alter von 16 Tagen. Ihre Gräber kennen wir nicht.
Der zweite Industriebetrieb, der gleich eine Rolle spielen wird, ist
die Firma Franz Hollenbach, Sortierbetrieb für Papier- und
Reißwollfabrikation, Wäscherei, Färberei, Duderstadt, Wolfsgärten
9. Hier arbeiteten etwa 20 Männer und 110 Frauen aus Polen und
der Sowjetunion, die in einem Lager auf dem Betriebsgelände
untergebracht waren. Das Lager bestand wahrscheinlich zum
einen aus zwei Wohnungen mit insgesamt acht Räumen in einem
Arbeiterhaus auf dem Firmengelände und zum anderen aus einer
dort aufgestellten Baracke. Mindestens 16 polnische Kinder
mussten ebenfalls hier leben und arbeiten. Der Einsatz polnischer
Arbeitskräfte bei Hollenbach begann bereits am 31.5.1940 mit der
Ankunft von 13 Frauen, die fast alle bis zur Befreiung 1945 bei der
Firma blieben (eine Polin wurde bereits 1941 in die „Irrenanstalt“
Göttingen eingeliefert). 1942 folgten 20 und 1944 37 Polinnen und
(wenige) Polen. Allein am 29.8.1944 kamen sieben Frauen mit
neun Kindern aus Polen zu Hollenbach. Dies waren vermutlich
Deportationen im Zusammenhang mit dem Warschauer Aufstand
von 1944.
© Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V. 2015
www.geschichtswerkstatt-duderstadt.de
Während des Zweiten Weltkrieges wurden Millionen zur
Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert – laut Nürnberger
Prozess ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Interview
mit Mirosław Kukliński zeigt, wie auch Kinder zu den Opfern
zählten.
Der vierjährige Mirosław erlebte Kämpfe während des
Warschauer Aufstandes und wurde mit seinen Eltern über das
Durchgangslager Pruszków in das KZ Sachsenhausen deportiert,
dann mit seiner Mutter weiter in das KZ Buchenwald und ins
Untereichsfeld. Teils aus den Erzählungen der Mutter, teils aus
eigener Erinnerung berichtet Mirosław Kukliński über ihr
Schicksal in der Ziegelei Jacobi in Bilshausen und in der
Reißwollfabrik Hollenbach in Duderstadt. Es ist ein subjektives
Erinnern an die Zeit als Zwangsarbeiterkind in Duderstadt, die
Befreiung durch Truppen der USA, das Schicksal als Displaced
Persons und das Wiederfinden des Vaters in Warschau. Mirosław
Kukliński erzählt, wie sein eigenes Leben nach dem Krieg
beeinflusst war durch eine Liebe zu den USA, die sich in
Duderstadt in der Begegnung mit den amerikanischen Befreiern
entwickelt hatte.
Die Darstellung unterschiedlicher Behandlung von zwei Gruppen
polnischer Zwangsarbeitenden in dem Interview konnte nicht
verifiziert werden. Allerdings: Während Zwangsarbeitende
üblicherweise durch das Arbeitsamt vermittelt wurden, kam die
Warschauer Gruppe aus dem KZ der SS.
Die DVD enthält das Interview mit Mirosław Kukliński in drei
Teilen:
Teil 1: Von Warschau ins Eichsfeld – 1944
Teil 2: Zwangsarbeit bei der Firma Hollenbach in Duderstadt –
1944/45
Teil 3: Befreiung und Rückkehr nach Warschau
Der Film wurde mit Unterstützung der Stiftung niedersächsische
Gedenkstätten und aus dem Projekt „Moving with the Exhibition“
der Geschichtswerkstatt Göttingen gefördert. Die eingeblendeten
Fotos stammen aus dem Bundesarchiv und von Mirosław
Kukliński. Interview: Götz Hütt. Kamera und Schnitt: Sascha
Heppe.
Günther Siedbürger: Einführung ins Thema NS-
Zwangsarbeit in Stadt und Altkreis Duderstadt
Etwa 13,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte und Häftlinge von
Konzentrationslagern und ähnlichen Haftstätten verrichteten
zwischen 1939 und 1945 Zwangsarbeit auf dem Gebiet des
„Großdeutschen Reichs“. Davon waren etwa 8,4 Millionen – also
der weitaus größte Teil – Zivilarbeiter, 1,7 Millionen Häftlinge aus
Konzentrationslagern, Ghettos und ähnlichen Lagern und etwa 3,4
Millionen Kriegsgefangene.
Alle drei Gruppen waren hier in Duderstadt vertreten:
Kriegsgefangene mit Arbeitskommandos in Industrie,
Landwirtschaft und einzelnen Handwerksbetrieben;
Ein Außenkommando des KZ Buchenwald mit 750 bzw. 755
jüdischen Frauen, die fast ausschließlich aus Ungarn kamen, in
der Rüstungsfabrik Poltewerke am Euzenberg;
Ausländische zivile Zwangsarbeitende praktisch überall: neben
der Landwirtschaft, in der in der Region knapp die Hälfte der
Zwangsarbeitenden eingesetzt wurde, arbeiteten sie in der
Industrie, bei der Eisenbahn, in Handel, Handwerk,
Gesundheitseinrichtungen wie dem Martini-Krankenhaus, in
der Forstwirtschaft und in kommunalen Betrieben.
Vor 30 Jahren war über Art und Umfang dieses
Kriegsverbrechens hier fast gar nichts bekannt. Das hat sich
mittlerweile zumindest für die Gruppen der KZ-Häftlinge und der
Zivilarbeiter geändert, während wir über die Situation der hier
eingesetzten Kriegsgefangenen nach wie vor nicht viel wissen.
Ausländische zivile Zwangsarbeitende prägten das tägliche Bild in
den Städten und Dörfern. Ihr Altersspektrum reichte von kleinen
Kindern bis zu Greisen, die alle zur Arbeit gezwungen wurden.
Ohne ihren Einsatz wäre die deutsche Wirtschaft
zusammengebrochen. Viele deutsche Betriebe haben von dem
Einsatz ausländischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wirtschaftlich profitiert.
Zivilarbeiterinnen und -arbeiter kamen aus einer Vielzahl von
Staaten und Nationen; für Südniedersachsen sind bisher 16
Herkunftsländer nachgewiesen. Fast zwei Drittel (61 %) kamen
aus Osteuropa. Die mit Abstand größte einzelne Gruppe (42 %)
stellten dabei die Bewohner Polens dar. Knapp zwei Drittel der
Zwangsarbeitenden in der Region waren männlichen
Geschlechts.
In ihrer Heimat wurden die Menschen als Arbeitskräfte
angeworben, „dienstverpflichtet“ oder – wie sehr häufig –
gewalttätig von der Straße weg deportiert. Unabhängig davon
einte sie, dass sie, einmal im Reich, nicht mehr in ihre Heimat
zurückkehren konnten, sondern praktisch Gefangene waren.
Dieser sogenannte Ausländereinsatz im Reich war ideologisch
eigentlich nicht erwünscht. Die nationalsozialistische
Rasseideologie nahm Abstufungen zwischen Angehörigen
„arischer“ Völker, zu denen z.B. Niederländer bzw. „Flamen“
zählten, „romanischer“ Völker (z.B. Franzosen und „Wallonen“)
und„slawischer“ Völker (z.B. Polen, Russen) vor. Die aus Polen
und der Sowjetunion deportierten Menschen galten als Slawen
und damit als Untermenschen. Ihr Stellenwert war der von
Arbeitstieren für die deutsche/ arische Herrenrasse. Für diese
Gruppe wurde ein Sonderstrafrecht eingeführt, das die
Lebensführung bis ins kleinste festlegte. Die Details ihres
Alltagslebens waren bis hin zum Friseurbesuch oder zum
Kirchgang reguliert und strafbewehrt. Insgesamt liefen diese
Regelungen auf eine möglichst weitgehende Beschränkung der
Bewegungsfreiheit, eine umfassende Isolierung und die
Herabstufung zum rechtlosen Objekt nationalsozialistischen
Herrschaftswillens hinaus. Merkblätter für die deutschen
Arbeitgeber und zahlreiche Hetzartikel in der Tagespresse sorgten
dafür, dass die einheimische Bevölkerung über diese Regelungen
genau (teilweise besser als die Betroffenen selbst) im Bilde war.
Die Betroffenen selbst schwebten in ständiger Gefahr, wegen
irgendwelcher Kleinigkeiten oder aufgrund von Denunziationen
verhaftet, ins Gefängnis oder Straflager gesteckt zu werden und
infolge dessen womöglich ihr Leben zu verlieren.
Mit dem Sonderstrafrecht für Polen wurde 1940 auch erstmals die
„Kennzeichenpflicht“ für eine Personengruppe im Reich
eingeführt. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wurden gezwungen, an ihrer Kleidung ständig ein „P“-Abzeichen
zu tragen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der
Verschleppung vieler dortiger Bewohner ins Reich wurde eine
entsprechende Regelung auch für diese Menschen geschaffen:
als sogenannte Ostarbeiter waren sie gezwungen, ein Abzeichen
mit dem Wort „OST“ an ihrer Kleidung zu tragen.
Hier in Stadt und Altkreis Duderstadt spielte die Industrie als
Einsatzort von Zwangsarbeitenden eine große Rolle. Vor
Kriegsbeginn herrschte hier eine sehr stark landwirtschaftlich
orientierte Wirtschafts- und Sozialstruktur vor. Das änderte sich im
Krieg rasant. Zwischen 1939 und 1944 wuchs die Zahl der
Einwohner der Stadt Duderstadt um 71 Prozent. An dieser
Steigerung hatten die vielen ausländischen Arbeitskräfte, die in
die Stadt gekommen bzw. dorthin verbracht worden waren,
großen Anteil. Sie arbeiteten in den lokalen Industriebetrieben und
in der Bauwirtschaft, der bei weitem größte Teil von ihnen in der
Stadt selbst bei Bau und Betrieb des Rüstungsunternehmens
Polte, im Kreis auf der Großbaustelle des chemischen Betriebes
Schickertwerke in Rhumspringe.
In dem Film spielen zwei andere Firmen eine Rolle. Da sind zum
einen die Jacobi Tonwerke mit ihrem Stammwerk in Bilshausen.
Hier arbeiteten während des Krieges ca. 220 Ausländer, sämtlich
aus Osteuropa, der größte Teil aus der Sowjetunion stammend, in
der Ziegelproduktion und bei Verladearbeiten. Fast
die Hälfte waren Frauen, es gab relativ viele Ehe- und
Geschwisterpaare, z. T. offenbar ganze Familien. Für diese
osteuropäischen Zwangsarbeitenden führte der Betrieb ein
eigenes Lager in vier festen Gebäuden innerhalb des
eingezäunten Fabrikgeländes, das sogenannte „Russenlager“,
das von einem deutschen „Betriebsobmann“ überwacht wurde.
Im Sommer 1944 häuften sich die hygienischen Missstände in
diesem Lager. Die Ungezieferplage, die ihre Ursache in
mangelhaften hygienischen Verhältnissen, unzureichender
Kleidung und wohl auch Überfüllung der Unterkünfte hatte, nahm
immer stärker zu. Da die einzige Entlausungsanlage im Altkreis
sich im 18 km entfernten Duderstädter Krankenhaus befand,
drängte die Firma beim Landrat auf die Aufstellung eines
zusätzlichen Entlausungsapparates direkt auf dem
Firmengelände.
Mindestens zwei Arbeiter aus der Sowjetunion, die bei Jacobi in
Bilshausen Zwangsarbeit leisten mussten, Grigory Popow und
Dmitry Pilipinko, starben 1943 bzw. 1944 an Lungentuberkulose.
1943 starb zudem im „Wohnlager Jakobi“ ein sowjetisches Kind
im Alter von 16 Tagen. Ihre Gräber kennen wir nicht.
Der zweite Industriebetrieb, der gleich eine Rolle spielen wird, ist
die Firma Franz Hollenbach, Sortierbetrieb für Papier- und
Reißwollfabrikation, Wäscherei, Färberei, Duderstadt, Wolfsgärten
9. Hier arbeiteten etwa 20 Männer und 110 Frauen aus Polen und
der Sowjetunion, die in einem Lager auf dem Betriebsgelände
untergebracht waren. Das Lager bestand wahrscheinlich zum
einen aus zwei Wohnungen mit insgesamt acht Räumen in einem
Arbeiterhaus auf dem Firmengelände und zum anderen aus einer
dort aufgestellten Baracke. Mindestens 16 polnische Kinder
mussten ebenfalls hier leben und arbeiten. Der Einsatz polnischer
Arbeitskräfte bei Hollenbach begann bereits am 31.5.1940 mit der
Ankunft von 13 Frauen, die fast alle bis zur Befreiung 1945 bei der
Firma blieben (eine Polin wurde bereits 1941 in die „Irrenanstalt“
Göttingen eingeliefert). 1942 folgten 20 und 1944 37 Polinnen und
(wenige) Polen. Allein am 29.8.1944 kamen sieben Frauen mit
neun Kindern aus Polen zu Hollenbach. Dies waren vermutlich
Deportationen im Zusammenhang mit dem Warschauer Aufstand
von 1944.
© Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V. 2015
www.geschichtswerkstatt-duderstadt.de
 1944-1946
1944-1946 Während des Zweiten Weltkrieges wurden Millionen zur
Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert – laut Nürnberger
Prozess ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Interview
mit Mirosław Kukliński zeigt, wie auch Kinder zu den Opfern
zählten.
Der vierjährige Mirosław erlebte Kämpfe während des
Warschauer Aufstandes und wurde mit seinen Eltern über das
Durchgangslager Pruszków in das KZ Sachsenhausen deportiert,
dann mit seiner Mutter weiter in das KZ Buchenwald und ins
Untereichsfeld. Teils aus den Erzählungen der Mutter, teils aus
eigener Erinnerung berichtet Mirosław Kukliński über ihr
Schicksal in der Ziegelei Jacobi in Bilshausen und in der
Reißwollfabrik Hollenbach in Duderstadt. Es ist ein subjektives
Erinnern an die Zeit als Zwangsarbeiterkind in Duderstadt, die
Befreiung durch Truppen der USA, das Schicksal als Displaced
Persons und das Wiederfinden des Vaters in Warschau. Mirosław
Kukliński erzählt, wie sein eigenes Leben nach dem Krieg
beeinflusst war durch eine Liebe zu den USA, die sich in
Duderstadt in der Begegnung mit den amerikanischen Befreiern
entwickelt hatte.
Die Darstellung unterschiedlicher Behandlung von zwei Gruppen
polnischer Zwangsarbeitenden in dem Interview konnte nicht
verifiziert werden. Allerdings: Während Zwangsarbeitende
üblicherweise durch das Arbeitsamt vermittelt wurden, kam die
Warschauer Gruppe aus dem KZ der SS.
Die DVD enthält das Interview mit Mirosław Kukliński in drei
Teilen:
Teil 1: Von Warschau ins Eichsfeld – 1944
Teil 2: Zwangsarbeit bei der Firma Hollenbach in Duderstadt –
1944/45
Teil 3: Befreiung und Rückkehr nach Warschau
Der Film wurde mit Unterstützung der Stiftung niedersächsische
Gedenkstätten und aus dem Projekt „Moving with the Exhibition“
der Geschichtswerkstatt Göttingen gefördert. Die eingeblendeten
Fotos stammen aus dem Bundesarchiv und von Mirosław
Kukliński. Interview: Götz Hütt. Kamera und Schnitt: Sascha
Heppe.
Günther Siedbürger: Einführung ins Thema NS-
Zwangsarbeit in Stadt und Altkreis Duderstadt
Etwa 13,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte und Häftlinge von
Konzentrationslagern und ähnlichen Haftstätten verrichteten
zwischen 1939 und 1945 Zwangsarbeit auf dem Gebiet des
„Großdeutschen Reichs“. Davon waren etwa 8,4 Millionen – also
der weitaus größte Teil – Zivilarbeiter, 1,7 Millionen Häftlinge aus
Konzentrationslagern, Ghettos und ähnlichen Lagern und etwa 3,4
Millionen Kriegsgefangene.
Alle drei Gruppen waren hier in Duderstadt vertreten:
Kriegsgefangene mit Arbeitskommandos in Industrie,
Landwirtschaft und einzelnen Handwerksbetrieben;
Ein Außenkommando des KZ Buchenwald mit 750 bzw. 755
jüdischen Frauen, die fast ausschließlich aus Ungarn kamen, in
der Rüstungsfabrik Poltewerke am Euzenberg;
Ausländische zivile Zwangsarbeitende praktisch überall: neben
der Landwirtschaft, in der in der Region knapp die Hälfte der
Zwangsarbeitenden eingesetzt wurde, arbeiteten sie in der
Industrie, bei der Eisenbahn, in Handel, Handwerk,
Gesundheitseinrichtungen wie dem Martini-Krankenhaus, in
der Forstwirtschaft und in kommunalen Betrieben.
Vor 30 Jahren war über Art und Umfang dieses
Kriegsverbrechens hier fast gar nichts bekannt. Das hat sich
mittlerweile zumindest für die Gruppen der KZ-Häftlinge und der
Zivilarbeiter geändert, während wir über die Situation der hier
eingesetzten Kriegsgefangenen nach wie vor nicht viel wissen.
Ausländische zivile Zwangsarbeitende prägten das tägliche Bild in
den Städten und Dörfern. Ihr Altersspektrum reichte von kleinen
Kindern bis zu Greisen, die alle zur Arbeit gezwungen wurden.
Ohne ihren Einsatz wäre die deutsche Wirtschaft
zusammengebrochen. Viele deutsche Betriebe haben von dem
Einsatz ausländischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wirtschaftlich profitiert.
Zivilarbeiterinnen und -arbeiter kamen aus einer Vielzahl von
Staaten und Nationen; für Südniedersachsen sind bisher 16
Herkunftsländer nachgewiesen. Fast zwei Drittel (61 %) kamen
aus Osteuropa. Die mit Abstand größte einzelne Gruppe (42 %)
stellten dabei die Bewohner Polens dar. Knapp zwei Drittel der
Zwangsarbeitenden in der Region waren männlichen
Geschlechts.
In ihrer Heimat wurden die Menschen als Arbeitskräfte
angeworben, „dienstverpflichtet“ oder – wie sehr häufig –
gewalttätig von der Straße weg deportiert. Unabhängig davon
einte sie, dass sie, einmal im Reich, nicht mehr in ihre Heimat
zurückkehren konnten, sondern praktisch Gefangene waren.
Dieser sogenannte Ausländereinsatz im Reich war ideologisch
eigentlich nicht erwünscht. Die nationalsozialistische
Rasseideologie nahm Abstufungen zwischen Angehörigen
„arischer“ Völker, zu denen z.B. Niederländer bzw. „Flamen“
zählten, „romanischer“ Völker (z.B. Franzosen und „Wallonen“)
und„slawischer“ Völker (z.B. Polen, Russen) vor. Die aus Polen
und der Sowjetunion deportierten Menschen galten als Slawen
und damit als Untermenschen. Ihr Stellenwert war der von
Arbeitstieren für die deutsche/ arische Herrenrasse. Für diese
Gruppe wurde ein Sonderstrafrecht eingeführt, das die
Lebensführung bis ins kleinste festlegte. Die Details ihres
Alltagslebens waren bis hin zum Friseurbesuch oder zum
Kirchgang reguliert und strafbewehrt. Insgesamt liefen diese
Regelungen auf eine möglichst weitgehende Beschränkung der
Bewegungsfreiheit, eine umfassende Isolierung und die
Herabstufung zum rechtlosen Objekt nationalsozialistischen
Herrschaftswillens hinaus. Merkblätter für die deutschen
Arbeitgeber und zahlreiche Hetzartikel in der Tagespresse sorgten
dafür, dass die einheimische Bevölkerung über diese Regelungen
genau (teilweise besser als die Betroffenen selbst) im Bilde war.
Die Betroffenen selbst schwebten in ständiger Gefahr, wegen
irgendwelcher Kleinigkeiten oder aufgrund von Denunziationen
verhaftet, ins Gefängnis oder Straflager gesteckt zu werden und
infolge dessen womöglich ihr Leben zu verlieren.
Mit dem Sonderstrafrecht für Polen wurde 1940 auch erstmals die
„Kennzeichenpflicht“ für eine Personengruppe im Reich
eingeführt. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wurden gezwungen, an ihrer Kleidung ständig ein „P“-Abzeichen
zu tragen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der
Verschleppung vieler dortiger Bewohner ins Reich wurde eine
entsprechende Regelung auch für diese Menschen geschaffen:
als sogenannte Ostarbeiter waren sie gezwungen, ein Abzeichen
mit dem Wort „OST“ an ihrer Kleidung zu tragen.
Hier in Stadt und Altkreis Duderstadt spielte die Industrie als
Einsatzort von Zwangsarbeitenden eine große Rolle. Vor
Kriegsbeginn herrschte hier eine sehr stark landwirtschaftlich
orientierte Wirtschafts- und Sozialstruktur vor. Das änderte sich im
Krieg rasant. Zwischen 1939 und 1944 wuchs die Zahl der
Einwohner der Stadt Duderstadt um 71 Prozent. An dieser
Steigerung hatten die vielen ausländischen Arbeitskräfte, die in
die Stadt gekommen bzw. dorthin verbracht worden waren,
großen Anteil. Sie arbeiteten in den lokalen Industriebetrieben und
in der Bauwirtschaft, der bei weitem größte Teil von ihnen in der
Stadt selbst bei Bau und Betrieb des Rüstungsunternehmens
Polte, im Kreis auf der Großbaustelle des chemischen Betriebes
Schickertwerke in Rhumspringe.
In dem Film spielen zwei andere Firmen eine Rolle. Da sind zum
einen die Jacobi Tonwerke mit ihrem Stammwerk in Bilshausen.
Hier arbeiteten während des Krieges ca. 220 Ausländer, sämtlich
aus Osteuropa, der größte Teil aus der Sowjetunion stammend, in
der Ziegelproduktion und bei Verladearbeiten. Fast
die Hälfte waren Frauen, es gab relativ viele Ehe- und
Geschwisterpaare, z. T. offenbar ganze Familien. Für diese
osteuropäischen Zwangsarbeitenden führte der Betrieb ein
eigenes Lager in vier festen Gebäuden innerhalb des
eingezäunten Fabrikgeländes, das sogenannte „Russenlager“,
das von einem deutschen „Betriebsobmann“ überwacht wurde.
Im Sommer 1944 häuften sich die hygienischen Missstände in
diesem Lager. Die Ungezieferplage, die ihre Ursache in
mangelhaften hygienischen Verhältnissen, unzureichender
Kleidung und wohl auch Überfüllung der Unterkünfte hatte, nahm
immer stärker zu. Da die einzige Entlausungsanlage im Altkreis
sich im 18 km entfernten Duderstädter Krankenhaus befand,
drängte die Firma beim Landrat auf die Aufstellung eines
zusätzlichen Entlausungsapparates direkt auf dem
Firmengelände.
Mindestens zwei Arbeiter aus der Sowjetunion, die bei Jacobi in
Bilshausen Zwangsarbeit leisten mussten, Grigory Popow und
Dmitry Pilipinko, starben 1943 bzw. 1944 an Lungentuberkulose.
1943 starb zudem im „Wohnlager Jakobi“ ein sowjetisches Kind
im Alter von 16 Tagen. Ihre Gräber kennen wir nicht.
Der zweite Industriebetrieb, der gleich eine Rolle spielen wird, ist
die Firma Franz Hollenbach, Sortierbetrieb für Papier- und
Reißwollfabrikation, Wäscherei, Färberei, Duderstadt, Wolfsgärten
9. Hier arbeiteten etwa 20 Männer und 110 Frauen aus Polen und
der Sowjetunion, die in einem Lager auf dem Betriebsgelände
untergebracht waren. Das Lager bestand wahrscheinlich zum
einen aus zwei Wohnungen mit insgesamt acht Räumen in einem
Arbeiterhaus auf dem Firmengelände und zum anderen aus einer
dort aufgestellten Baracke. Mindestens 16 polnische Kinder
mussten ebenfalls hier leben und arbeiten. Der Einsatz polnischer
Arbeitskräfte bei Hollenbach begann bereits am 31.5.1940 mit der
Ankunft von 13 Frauen, die fast alle bis zur Befreiung 1945 bei der
Firma blieben (eine Polin wurde bereits 1941 in die „Irrenanstalt“
Göttingen eingeliefert). 1942 folgten 20 und 1944 37 Polinnen und
(wenige) Polen. Allein am 29.8.1944 kamen sieben Frauen mit
neun Kindern aus Polen zu Hollenbach. Dies waren vermutlich
Deportationen im Zusammenhang mit dem Warschauer Aufstand
von 1944.
© Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V. 2015
www.geschichtswerkstatt-duderstadt.de
Während des Zweiten Weltkrieges wurden Millionen zur
Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert – laut Nürnberger
Prozess ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Interview
mit Mirosław Kukliński zeigt, wie auch Kinder zu den Opfern
zählten.
Der vierjährige Mirosław erlebte Kämpfe während des
Warschauer Aufstandes und wurde mit seinen Eltern über das
Durchgangslager Pruszków in das KZ Sachsenhausen deportiert,
dann mit seiner Mutter weiter in das KZ Buchenwald und ins
Untereichsfeld. Teils aus den Erzählungen der Mutter, teils aus
eigener Erinnerung berichtet Mirosław Kukliński über ihr
Schicksal in der Ziegelei Jacobi in Bilshausen und in der
Reißwollfabrik Hollenbach in Duderstadt. Es ist ein subjektives
Erinnern an die Zeit als Zwangsarbeiterkind in Duderstadt, die
Befreiung durch Truppen der USA, das Schicksal als Displaced
Persons und das Wiederfinden des Vaters in Warschau. Mirosław
Kukliński erzählt, wie sein eigenes Leben nach dem Krieg
beeinflusst war durch eine Liebe zu den USA, die sich in
Duderstadt in der Begegnung mit den amerikanischen Befreiern
entwickelt hatte.
Die Darstellung unterschiedlicher Behandlung von zwei Gruppen
polnischer Zwangsarbeitenden in dem Interview konnte nicht
verifiziert werden. Allerdings: Während Zwangsarbeitende
üblicherweise durch das Arbeitsamt vermittelt wurden, kam die
Warschauer Gruppe aus dem KZ der SS.
Die DVD enthält das Interview mit Mirosław Kukliński in drei
Teilen:
Teil 1: Von Warschau ins Eichsfeld – 1944
Teil 2: Zwangsarbeit bei der Firma Hollenbach in Duderstadt –
1944/45
Teil 3: Befreiung und Rückkehr nach Warschau
Der Film wurde mit Unterstützung der Stiftung niedersächsische
Gedenkstätten und aus dem Projekt „Moving with the Exhibition“
der Geschichtswerkstatt Göttingen gefördert. Die eingeblendeten
Fotos stammen aus dem Bundesarchiv und von Mirosław
Kukliński. Interview: Götz Hütt. Kamera und Schnitt: Sascha
Heppe.
Günther Siedbürger: Einführung ins Thema NS-
Zwangsarbeit in Stadt und Altkreis Duderstadt
Etwa 13,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte und Häftlinge von
Konzentrationslagern und ähnlichen Haftstätten verrichteten
zwischen 1939 und 1945 Zwangsarbeit auf dem Gebiet des
„Großdeutschen Reichs“. Davon waren etwa 8,4 Millionen – also
der weitaus größte Teil – Zivilarbeiter, 1,7 Millionen Häftlinge aus
Konzentrationslagern, Ghettos und ähnlichen Lagern und etwa 3,4
Millionen Kriegsgefangene.
Alle drei Gruppen waren hier in Duderstadt vertreten:
Kriegsgefangene mit Arbeitskommandos in Industrie,
Landwirtschaft und einzelnen Handwerksbetrieben;
Ein Außenkommando des KZ Buchenwald mit 750 bzw. 755
jüdischen Frauen, die fast ausschließlich aus Ungarn kamen, in
der Rüstungsfabrik Poltewerke am Euzenberg;
Ausländische zivile Zwangsarbeitende praktisch überall: neben
der Landwirtschaft, in der in der Region knapp die Hälfte der
Zwangsarbeitenden eingesetzt wurde, arbeiteten sie in der
Industrie, bei der Eisenbahn, in Handel, Handwerk,
Gesundheitseinrichtungen wie dem Martini-Krankenhaus, in
der Forstwirtschaft und in kommunalen Betrieben.
Vor 30 Jahren war über Art und Umfang dieses
Kriegsverbrechens hier fast gar nichts bekannt. Das hat sich
mittlerweile zumindest für die Gruppen der KZ-Häftlinge und der
Zivilarbeiter geändert, während wir über die Situation der hier
eingesetzten Kriegsgefangenen nach wie vor nicht viel wissen.
Ausländische zivile Zwangsarbeitende prägten das tägliche Bild in
den Städten und Dörfern. Ihr Altersspektrum reichte von kleinen
Kindern bis zu Greisen, die alle zur Arbeit gezwungen wurden.
Ohne ihren Einsatz wäre die deutsche Wirtschaft
zusammengebrochen. Viele deutsche Betriebe haben von dem
Einsatz ausländischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wirtschaftlich profitiert.
Zivilarbeiterinnen und -arbeiter kamen aus einer Vielzahl von
Staaten und Nationen; für Südniedersachsen sind bisher 16
Herkunftsländer nachgewiesen. Fast zwei Drittel (61 %) kamen
aus Osteuropa. Die mit Abstand größte einzelne Gruppe (42 %)
stellten dabei die Bewohner Polens dar. Knapp zwei Drittel der
Zwangsarbeitenden in der Region waren männlichen
Geschlechts.
In ihrer Heimat wurden die Menschen als Arbeitskräfte
angeworben, „dienstverpflichtet“ oder – wie sehr häufig –
gewalttätig von der Straße weg deportiert. Unabhängig davon
einte sie, dass sie, einmal im Reich, nicht mehr in ihre Heimat
zurückkehren konnten, sondern praktisch Gefangene waren.
Dieser sogenannte Ausländereinsatz im Reich war ideologisch
eigentlich nicht erwünscht. Die nationalsozialistische
Rasseideologie nahm Abstufungen zwischen Angehörigen
„arischer“ Völker, zu denen z.B. Niederländer bzw. „Flamen“
zählten, „romanischer“ Völker (z.B. Franzosen und „Wallonen“)
und„slawischer“ Völker (z.B. Polen, Russen) vor. Die aus Polen
und der Sowjetunion deportierten Menschen galten als Slawen
und damit als Untermenschen. Ihr Stellenwert war der von
Arbeitstieren für die deutsche/ arische Herrenrasse. Für diese
Gruppe wurde ein Sonderstrafrecht eingeführt, das die
Lebensführung bis ins kleinste festlegte. Die Details ihres
Alltagslebens waren bis hin zum Friseurbesuch oder zum
Kirchgang reguliert und strafbewehrt. Insgesamt liefen diese
Regelungen auf eine möglichst weitgehende Beschränkung der
Bewegungsfreiheit, eine umfassende Isolierung und die
Herabstufung zum rechtlosen Objekt nationalsozialistischen
Herrschaftswillens hinaus. Merkblätter für die deutschen
Arbeitgeber und zahlreiche Hetzartikel in der Tagespresse sorgten
dafür, dass die einheimische Bevölkerung über diese Regelungen
genau (teilweise besser als die Betroffenen selbst) im Bilde war.
Die Betroffenen selbst schwebten in ständiger Gefahr, wegen
irgendwelcher Kleinigkeiten oder aufgrund von Denunziationen
verhaftet, ins Gefängnis oder Straflager gesteckt zu werden und
infolge dessen womöglich ihr Leben zu verlieren.
Mit dem Sonderstrafrecht für Polen wurde 1940 auch erstmals die
„Kennzeichenpflicht“ für eine Personengruppe im Reich
eingeführt. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wurden gezwungen, an ihrer Kleidung ständig ein „P“-Abzeichen
zu tragen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der
Verschleppung vieler dortiger Bewohner ins Reich wurde eine
entsprechende Regelung auch für diese Menschen geschaffen:
als sogenannte Ostarbeiter waren sie gezwungen, ein Abzeichen
mit dem Wort „OST“ an ihrer Kleidung zu tragen.
Hier in Stadt und Altkreis Duderstadt spielte die Industrie als
Einsatzort von Zwangsarbeitenden eine große Rolle. Vor
Kriegsbeginn herrschte hier eine sehr stark landwirtschaftlich
orientierte Wirtschafts- und Sozialstruktur vor. Das änderte sich im
Krieg rasant. Zwischen 1939 und 1944 wuchs die Zahl der
Einwohner der Stadt Duderstadt um 71 Prozent. An dieser
Steigerung hatten die vielen ausländischen Arbeitskräfte, die in
die Stadt gekommen bzw. dorthin verbracht worden waren,
großen Anteil. Sie arbeiteten in den lokalen Industriebetrieben und
in der Bauwirtschaft, der bei weitem größte Teil von ihnen in der
Stadt selbst bei Bau und Betrieb des Rüstungsunternehmens
Polte, im Kreis auf der Großbaustelle des chemischen Betriebes
Schickertwerke in Rhumspringe.
In dem Film spielen zwei andere Firmen eine Rolle. Da sind zum
einen die Jacobi Tonwerke mit ihrem Stammwerk in Bilshausen.
Hier arbeiteten während des Krieges ca. 220 Ausländer, sämtlich
aus Osteuropa, der größte Teil aus der Sowjetunion stammend, in
der Ziegelproduktion und bei Verladearbeiten. Fast
die Hälfte waren Frauen, es gab relativ viele Ehe- und
Geschwisterpaare, z. T. offenbar ganze Familien. Für diese
osteuropäischen Zwangsarbeitenden führte der Betrieb ein
eigenes Lager in vier festen Gebäuden innerhalb des
eingezäunten Fabrikgeländes, das sogenannte „Russenlager“,
das von einem deutschen „Betriebsobmann“ überwacht wurde.
Im Sommer 1944 häuften sich die hygienischen Missstände in
diesem Lager. Die Ungezieferplage, die ihre Ursache in
mangelhaften hygienischen Verhältnissen, unzureichender
Kleidung und wohl auch Überfüllung der Unterkünfte hatte, nahm
immer stärker zu. Da die einzige Entlausungsanlage im Altkreis
sich im 18 km entfernten Duderstädter Krankenhaus befand,
drängte die Firma beim Landrat auf die Aufstellung eines
zusätzlichen Entlausungsapparates direkt auf dem
Firmengelände.
Mindestens zwei Arbeiter aus der Sowjetunion, die bei Jacobi in
Bilshausen Zwangsarbeit leisten mussten, Grigory Popow und
Dmitry Pilipinko, starben 1943 bzw. 1944 an Lungentuberkulose.
1943 starb zudem im „Wohnlager Jakobi“ ein sowjetisches Kind
im Alter von 16 Tagen. Ihre Gräber kennen wir nicht.
Der zweite Industriebetrieb, der gleich eine Rolle spielen wird, ist
die Firma Franz Hollenbach, Sortierbetrieb für Papier- und
Reißwollfabrikation, Wäscherei, Färberei, Duderstadt, Wolfsgärten
9. Hier arbeiteten etwa 20 Männer und 110 Frauen aus Polen und
der Sowjetunion, die in einem Lager auf dem Betriebsgelände
untergebracht waren. Das Lager bestand wahrscheinlich zum
einen aus zwei Wohnungen mit insgesamt acht Räumen in einem
Arbeiterhaus auf dem Firmengelände und zum anderen aus einer
dort aufgestellten Baracke. Mindestens 16 polnische Kinder
mussten ebenfalls hier leben und arbeiten. Der Einsatz polnischer
Arbeitskräfte bei Hollenbach begann bereits am 31.5.1940 mit der
Ankunft von 13 Frauen, die fast alle bis zur Befreiung 1945 bei der
Firma blieben (eine Polin wurde bereits 1941 in die „Irrenanstalt“
Göttingen eingeliefert). 1942 folgten 20 und 1944 37 Polinnen und
(wenige) Polen. Allein am 29.8.1944 kamen sieben Frauen mit
neun Kindern aus Polen zu Hollenbach. Dies waren vermutlich
Deportationen im Zusammenhang mit dem Warschauer Aufstand
von 1944.
© Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V. 2015
www.geschichtswerkstatt-duderstadt.de












