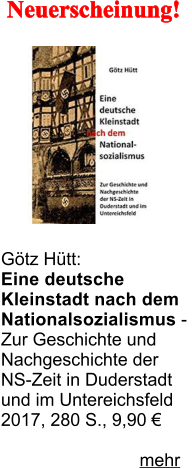Anreischke - Geschichte eines vermeintlichen
Judenkopfes
Die Jahrzehnte nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges sind längst
Gegenstand der historischen
Forschung geworden. Daher erscheint
es angebracht zu fragen: In welcher
Weise ging man in Duderstadt nach
1945 mit der Erinnerung an die NS-
Zeit um und welche Auswirkungen auf
das Handeln ergaben sich daraus?
Ein Beispiel für die Zeit der fünfziger
Jahre des letzten Jahrhunderts ist die
Installation einer Nachbildung des
Anreischke in einem der
Rathaustürme.
Der Anreischke, Wahrzeichen von
Duderstadt, wurde 1988 einer
gründlichen wissenschaftlichen
Untersuchung unterzogen. Ziel war
herauszufinden, was denn die ursprüngliche Bedeutung dieser
Holzfigur sei. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Die ursprüngliche
Bedeutung der Figur konnte nicht geklärt werden. Eindeutig wurde
allerdings die Annahme widerlegt, der Anreischke stelle eine
antijüdische Spottfigur dar. Das Ergebnis der Untersuchung
veröffentlichte Stadtarchivar Dr. Ebeling 1989 in der Zeitschrift „Die
Goldene Mark“ des gleichnamigen Heimatvereins im Untereichsfeld.
In den Jahren 1958/1959 jedoch war der Kenntnisstand in Duderstadt
ein ganz anderer. Und das ist für unser Thema aufschlussreich.
„Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Bild stellt die Karrikatur [!]
eines Judenkopfes dar, welche die Züge des jüdischen Typus in
stärkster Übertreibung wiedergiebt. Der Spitzhut, den die Figur trägt
(…), war die den Juden gesetzlich vorgeschriebene Kopfbedeckung.
Daß die Figur beim Schlagen der Uhr, den Kopf hin und her drehte,
entsprach der humorvollen Würdigung jüdischer Beweglichkeit. In der
ganzen Einrichtung erkennen wir die Neigung der Zeit, die Juden zu
bedrücken und zu verspotten(…).“
(Jaeger 1910, S. 60f.)
Diese Deutung aus dem Jahr 1910 stammt von Julius Jäger, dem
damaligen Direktor des Duderstädter Gymnasiums für Jungen und
anerkannten Heimatforscher. Jäger war es auch, der in alten
Rechnungsbüchern der Stadt auf den ‚Polackenmeister’ Andreas
aufmerksam geworden war, welcher die Arbeiten zum Bau des
Stadtwalls beaufsichtigt hatte. Von diesem Andreas leitete Jäger rein
spekulativ die Herkunft des Spitznamens Anreischken der Duderstädter
ab. Dieser Name sei dann auch auf den Judenkopf übertragen worden.
Über die bloße Namensgleichheit hinaus aber, so betonte Jäger, hätten
der Wallbaumeister und der Judenkopf nichts miteinander zu tun.
Die Erkenntnisse Jägers überzeugten. Karl Wüstefeld übernahm sie in
sein Buch „Das tausendjährige Duderstadt“, das zur Tausendjahrfeier
1929 erschien. Ebenso beschrieb 1939 Stadtarchivar Kretzschmar den
Anreischken als Darstellung eines Juden (Stadtarchiv Duderstadt), wie
auch 1974 Boegehold in einem Aufsatz in der Zeitschrift „Die Goldene
Mark“. 1988 nach dem Anreischken befragt, wies der damalige
Ortsheimatpfleger von Duderstadt uneingeschränkt auf die
Darstellungen von Jäger und Wüstefeld hin. – Jägers Thesen fanden
also weite Verbreitung in Duderstadt. Sie wurden, wie Stadtarchivar
Ebeling 1989 feststellte, „zum allgemein akzeptierten Wissen in der
Stadt“ . (Ebeling 1989, S. 19.) Der Anreischke galt also 1958/59 nach
damaligem Kenntnisstand unbestritten als die Karikatur eines
Judenkopfes, zumindest für alle in der Duderstädter Heimatkunde
Bewanderten. Das besagt bis hierher noch nichts darüber, welche
Bedeutung diesem Wissen beigemessen wurde, zumal in einer
städtischen Gesellschaft, die sich des Schicksals der Juden im NS-
Staat wenig erinnerte, und ob nicht andere Projektionen in die Figur, z.
B. Wahrzeichen der Stadt zu sein, auch emotional viel wichtiger
erschienen und weitaus mehr im Vordergrund standen als das
Charakteristikum „Jude“.
1958 plante die Stadt Duderstadt, zur Hebung der Kultur und des
Fremdenverkehrs eine Nachbildung in einem Rathausturm zu
installieren. Stadtdirektor Schäfer formulierte Zuschussanträge:
„Seit Jahren besteht hier der Wunsch, ein elektrisches Glockenspiel mit
der historischen Figur des ‚Anreischken’ im westlichen Eckturm unseres
Rathauses anzubringen. (…) Wie die Stadtgeschichte ausweist, hat
sich die Bezeichnung ‚Anreischke’ aus dem Namen Andreas entwickelt;
ein Mann dieses Namens war beim Bau der Duderstädter Wallanlagen
von 1508 bis 1521 als Aufseher tätig (…).
Um die mit dem Abbau des Steintores unterbrochene Tradition mit dem
‚Anreischken’ wieder aufleben zu lassen, hat der Rat trotz finanzieller
Bedenken beschlossen, eine größere Nachbildung der ‚Anreischken’-
Figur zusammen mit einem Glockenspiel, das die Stadthymne ‚Mein
Duderstadt am Brehmestrand … ‚ intonieren soll, im Rathaus zu
errichten und damit der Allgemeinheit einen kulturellen Beitrag zu liefern
….“
(Stadtarchiv Duderstadt)
Schäfer berief sich also auf die Literatur zur Heimatgeschichte. Auch
seinen Formulierungen lagen die Thesen Jägers zugrunde. Aber der
Stadtdirektor veränderte sie: Die Jäger’sche Deutung der Figur als
Judenkopf ließ er in seiner Darstellung weg.
1959 wurde das Vorhaben bekanntermaßen umgesetzt, gegen
Einwände des bereits erwähnten Ratsherrn Boegehold. Fortan
verbeugte sich die Nachbildung des Anreischke zu bestimmten Zeiten
vom Rathausturm in Richtung Marktstraße. Sie war mit einer neuen,
harmlosen Identität versehen – mit der einer historischen Figur, eines
Wahrzeichens der Stadt. Irgendwann wurde sie als Nachbildung des
Wallbaumeisters Andreas bezeichnet. Hinzu kam die Melodie des
Glockenspiels. Durch sie wurde die Figur mit dem Text des
Heimatliedes „Mein Duderstadt am Brehmestrand“ in Verbindung
gebracht, dessen Refrain lautet „Wir halten treu und fest zusammen“.
Der Judenkopf und „Wir halten treu und fest zusammen“ – das klingt
wie Hohn, nachdem die jüdischen Einwohner Duderstadts nicht sehr
viele Jahre zuvor ausgegrenzt, deportiert und ermordet worden waren.
Es war aber offensichtlich nicht so gemeint, was sich schon daraus
ergibt, dass der Anreischke zur positiv verstandenen Symbolfigur der
Duderstädter werden konnte. Das hatte aber ein doppeltes Verdrängen
zur Voraussetzung. Zum einen wurde das vermeintliche Wissen
beiseitegeschoben, der Anreischke sei ein Judenkopf. Zum andern war
das Schicksal der europäischen einschließlich der Duderstädter Juden
aus dem Bewusstsein ferngehalten. Ohne Gleichgültigkeit gegenüber
der Vernichtung der Juden unter der NS-Herrschaft, ohne
Gedankenlosigkeit, ohne Verdrängen und Vergessen hätte die
Nachbildung des vermeintlichen Judenkopfes nicht im Rathausturm
installiert werden können.
Der Anreischke konnte nach der 1988 für ihn günstig ausgegangenen
Untersuchung zu Recht in seinem Turm bleiben. Es bleibt aber auch
Teil der Duderstädter Nachkriegsgeschichte, wie der Duderstädter
Stadtrat 1958/59 völlig unsensibel mit dem vermeintlichen Judenkopf
umging und dass mit Ausnahme des Ratsherrn Boegehold damals
niemand Einspruch erhob. Dieser Vorgang kennzeichnet das Ausmaß
des Verdrängens damals in Duderstadt.
Literatur:
Ebeling, Hans-Heinrich: Der Duderstädter Anreischke.
In: Die Goldene Mark, 40. Jg., 1989, Heft 1-4, S. 19 – 41.
Götz Hütt: Geschichte der neuzeitlichen jüdischen Gemeinde in
Duderstadt, 184 S., 14 €, erschienen im August 2012, ISBN
978348218660.
Jäger, Julius (1910): Wie sind die Duderstädter zu dem Spitznamen
Anreischken gekommen.
In: Heimatland 6, 1909/1910.
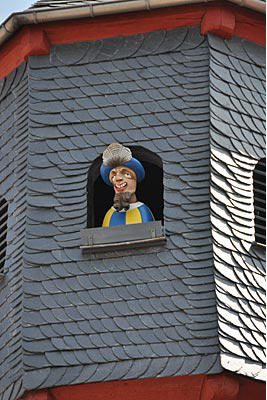

Themen:
NS-Zwangsarbeit
- Zwangsarbeiterkind
in Duderstadt
KZ-Außenlager
Jüdische Gemeinde:
- Geschichte
- jüdischer Friedhof
- Friedhof 1953
- Vernichtung
- Stolpersteine
Nationalsozialismus
und Duderstadt
- Verdrängte Realität
- Bgm. Dornieden
- Richter Trümper
- Priester R. Kleine
Nachgeschichte des
Nationalsozialismus:
- bürgerliche Alt-Nazis
- Kriegsgräber
- Anreischke
- Rechtsextremismus
Friedensglobus
Kriegsgefangene
Hinweis:
Die
Geschichtswerkstatt
Duderstadt e.V.
wurde vom
Finanzamt Northeim
als gemeinnützig
anerkannt und kann
Spendenquittungen
ausstellen.
Bankverbindung der
Geschichtswerkstatt:
Sparkasse
Duderstadt (BLZ
26051260), Konto
Nummer 116830