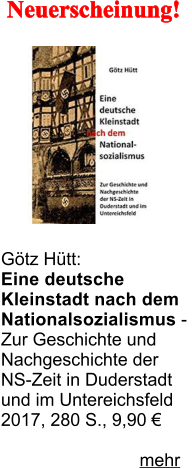Themen:
NS-Zwangsarbeit
- Zwangsarbeiterkind
in Duderstadt
KZ-Außenlager
Jüdische Gemeinde:
- Geschichte
- jüdischer Friedhof
- Friedhof 1953
- Vernichtung
- Stolpersteine
Nationalsozialismus
und Duderstadt
- Verdrängte Realität
- Bgm. Dornieden
- Richter Trümper
- Priester R. Kleine
Nachgeschichte des
Nationalsozialismus:
- bürgerliche Alt-Nazis
- Kriegsgräber
- Anreischke
- Rechtsextremismus
Friedensglobus
Kriegsgefangene
Hinweis:
Die
Geschichtswerkstatt
Duderstadt e.V.
wurde vom
Finanzamt Northeim
als gemeinnützig
anerkannt und kann
Spendenquittungen
ausstellen.
Bankverbindung der
Geschichtswerkstatt:
Sparkasse
Duderstadt (BLZ
26051260), Konto
Nummer 116830









Andreas Dornieden - Bürgermeister von 1933-1945
Bürgermeister Andreas Dornieden hatte zwei sehr
unterschiedliche Gesichter. Zum einen das desjenigen, der als
NSDAP-Kreisleiter von 1933-1937 und als NS-Bürgermeister
von 1933-1945 in Duderstadt dem verbrecherischen „Dritten
Reich“ diente und dabei seine nationalsozialistische
Grundüberzeugung mit dem christlichem Glauben vereinbaren
konnte. Ansehen errang er sich auch dadurch, dass er sich für
die Verbesserung der Infrastruktur von Duderstadt einsetzte
und für viele Anliegen der Einwohner nach Kräften eintrat –
allerdings begrenzt auf die „Volksgenossen“. Die Maske, die er
sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufsetzte, war
dann das Gesicht eines Mannes, der nicht nur seine ganze
Arbeitskraft dem Wohl der Stadt und ihren Bewohnern
gewidmet, sondern dabei auch frühzeitig begonnen hatte, sich
vom Nationalsozialismus abzuwenden und innerlich zu seinem
Gegner zu wandeln. Die Täuschung gelang und führte dazu,
dass Dornieden, der prominenteste Nationalsozialist des
Untereichsfeldes, im Entnazifizierungsverfahren mit
Unterstützung durch viele Duderstädter als Entlasteter
eingestuft wurde.

Andreas Dornieden war von 1933 bis 1945 Bürgermeister der Stadt
Duderstadt. Das Amt des Kreisparteileiters der NSDAP im Landkreis
Duderstadt übte er von 1933-1937 und dann wieder während des
Zweiten Weltkrieges von 1939-1941 in Vertretung seines zur
Wehrmacht eingezogenen Nachfolgers aus. 1936 wurde er zum
Mitglied des Reichstags ernannt. Kurz, er war der prominenteste
Nationalsozialist im Untereichsfeld und auch nach 1945 von der
Richtigkeit seines Handelns überzeugt, weil, wie er sich 1948 im
Entnazifizierungsverfahren zuschrieb, „meine Tätigkeit als
Bürgermeister u. nebenamtlicher Kreisleiter weitgehend von der Sorge
um das Wohlergehen der Bevölkerung bestimmt wurde und mein
Verbleiben in den Ämtern im ureigensten Interesse der Allgemeinheit
lag, da ich nicht nur keinen Missbrauch getrieben, sondern auch den
beabsichtigten Missbrauch anderer unter vollem Einsatz meiner
Person nach Kräften verhindert habe“. [1]
Das sahen andere in Duderstadt ähnlich. Der Duderstädter Propst
Ernst bescheinigte ihm 1945: „Ich habe Herrn Dornieden in der Zeit
vom März 1943 bis April 1945 in Duderstadt kennengelernt. In dieser
Zeit hat Herr Dornieden regelmäßig und öffentlich am Gottesdienst und
Sakramentenempfang teilgenommen. Dem kirchlichen Leben in der
Stadt hat er keinerlei Schwierigkeiten bereitet und stand den
kirchlichen Einrichtungen als Bürgermeister wohlwollend gegenüber.“
[2] Adolf Bolte, Weihbischof von Fulda, erklärte 1947, Propst
Algermissen, der Vorgänger von Propst Ernst, habe ihm gesagt,
Dornieden sei „ein treuer, aufrechter Katholik, er setzt sich für die
Erziehung der Jugend im christlichen Sinne ein, er hilft, dass
katholische Einrichtungen erhalten bleiben. Ich habe ihn direkt
gebeten, sein Amt nicht niederzulegen, sondern im Interesse der
Kirche weiterzuführen.“ [3]
. Zahlreiche Einwohner von Duderstadt stellten Dornieden weitere so
genannte „Persilscheine“ aus – eidesstattliche Erklärungen, die ihn von
seinem verantwortlichen Mittun im NS-Staat entlasteten.
Solche entlastenden Bestätigungen der eigenen Aussagen
einzuholen war nach 1945 gängige Praxis der Beschuldigten und vor
der Spruchkammer Angeklagten. Christina Ullrich hat diese
Vorgehensweise beschrieben: „Die eidesstattlichen Erklärungen hatten
aus Sicht der Betroffenen den Zweck, die eigene Argumentation und
Darstellung zu belegen und die Sicht der Spruchkammern zu
widerlegen. Die Leumünder wurden gezielt ausgesucht, um den
Bestätigungen möglichst viel Gewicht und Glaubwürdigkeit zu
verleihen. Auch die Inhalte waren nicht willkürlich, sondern wurden
genau von den Betroffenen vorgegeben, indem sie darum baten, dass
man ihnen bestimmte Dinge bestätigen möge.“[4]
Nun hatte Bürgermeister Dornieden sich aber in der Amtszeit der
beiden Pröpste nicht nur als praktizierender und treuer Katholik
gezeigt, sondern war entgegen der eigenen Darstellung und öffentlich
erkennbar, auch als aktiven Parteigänger der NSDAP für vieles
unrechtmäßige Handeln während der NS-Zeit in Duderstadt
mitverantwortlich geworden.
Andreas Dornieden war 1933 ein Totengräber der Demokratie im
Untereichsfeld. Als Kreisparteileiter der NSDAP setzte er die
rechtswidrige Amtsenthebung zahlreicher Bürgermeister durch und
verhinderte den Amtsantritt mehrerer im März noch demokratisch
gewählter Gemeindevorsteher. Er war Antisemit und beteiligt an der
Unterdrückung und Verfolgung der Juden in Duderstadt. Er war
Rassist und wirkte mit am Verbrechen der NS-Zwangsarbeit. Er
wandelte sich keineswegs, wie er nach 1945 behauptete, in den
Anfangsjahren des „Dritten Reiches“ zum Gegner der Nazi-Ideologie.
So sagte er zum Beispiel am 8.10.1940 in einer Rede: „Die Lehren
und Grundsätze der nationalsozialistischen Weltanschauung müssen
in der Bevölkerung immer tiefer verankert werden, damit alle auch die
Ereignisse unserer Tage unter nationalsozialistischem Blickwinkel
sehen und die zuversichtliche Stimmung und das Vertrauen zum
Führer weiter wachsen.“[5] Im Krieg rief er dazu auf, Opfer „bis zum
Letzten“ [6] zu erbringen.
Im Entnazifizierungsverfahren 1948 gelang es Andreas Dornieden
mit Hilfe seiner Duderstädter Zeugen, den Entnazifizierungs-
Hauptausschuss von seiner Gegnerschaft gegenüber dem
Nationalsozialismus zu überzeugen. So kam es zu dem absurden
Ergebnis, dass Andreas Dornieden, welcher an führender Stelle im
Untereichsfeld einem von Grund auf verbrecherischen System bis
1945 gedient hatte, als Entlasteter eingestuft wurde.
Andreas Dornieden starb am 4. März 1976 in Herne. Nun
vollendete die Stadt Duderstadt seine Entnazifizierung. Sie
veröffentlichte einen Nachruf, in dem sie ihm „herzlich Dank“ sagten
und ein „ehrendes Gedenken“ zusicherten [7]. Die Dimension seines
Wirkens als Nationalsozialist erwähnte sie nicht. Aber das
Versprechen des wertschätzenden Gedenkens wurde eingehalten. Ein
Bild Dorniedens hängt heute in einer Fotogalerie der früheren
Bürgermeister im Stadthaus, ohne Unterscheidung – als sei er auch
gegenwärtig für Duderstadt gleichermaßen ehrenwert wie die
Bürgermeister der anderen Jahre.
[1] HStA Hannover: Hann 171 Hild. Nr. 21490.
[2] Kreisarchiv Göttingen: LK DUD Nr. 20.
[3] HStA Hannover: Hann 171 Hild. Nr. 21490.
[4] Ullrich, Christina (2011): S. 71 f.
[5] „Die Winterarbeit der Partei beginnt“, Südhannoversche Zeitung
am 8.10.1940.
[6] “Wir werden opfern bis zum Letzten! - Dann wird der Sieg unser
sein!”, Südhannoversche Volkszeitung am 16.10.1939.
[7] Anzeige im SPOT, 26.3.1976.
[Als weiterführende Literatur erscheint demnächst in der Schriftenreihe
der Geschichtswerkstatt Duderstadt: Götz Hütt, Duderstadt nach dem
Nationalsozialismus. Zur Geschichte und Nachgeschichte der NS-Zeit
im Untereichsfeld.]