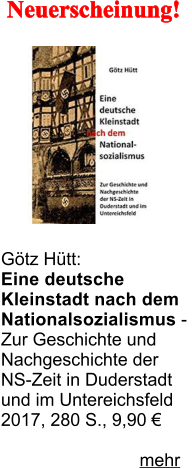Duderstadt und der Nationalsozialismus
Freilegung einer verdrängten Realität
Oft ist erklärt worden, die Duderstädter hätten zum Nationalsozialismus
in Opposition gestanden. Es ist häufig auf die Reichstagswahl am 5.
März 1933 hingewiesen worden. Bei dieser Wahl erhielt das Zentrum in
Duderstadt 41,5 Prozent der Stimmen, die NSDAP 33,9 Prozent. Damit
blieben die Nationalsozialisten in Duderstadt auch deutlich hinter dem
Gesamtergebnis ihrer Partei im Deutschen Reich zurück. Die NSDAP
hatte insgesamt 43,9 Prozent der Stimmen erhalten. In den
Landgemeinden um Duderstadt herum schnitt die NSDAP in der Regel
noch erheblich schwächer ab. Dieses politische Meinungsbild vom März
1933 kann aber nicht auf die gesamte NS-Zeit übertragen werden –
noch nicht einmal auf die nächsten Monate. Um das zu verdeutlichen,
müssen wir nur auf die beiden christlichen Kirchen in Duderstadt
schauen – als den hier besonders einflussreichen gesellschaftlichen
Institutionen.
Bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 hatten die Mitglieder der
Evangelischen Landeskirche Hannovers mit der Mehrheit ihrer Stimmen
für die NSDAP votiert. (Röhrbein 1996.) Im April 1933 unterschrieb der
hannoversche Landesbischof Marahrens eine Ergebenheitsadresse:
„Eine mächtige nationale Bewegung hat unser deutsches Volk ergriffen
und emporgehoben. Eine umfassende Neugestaltung des Reiches in
der erwachten deutschen Nation schafft sich Raum. Zu dieser Wende
der Geschichte sprechen wir ein dankbares Ja. Gott hat sie uns
geschenkt. Ihm sei die Ehre.“
(Abgedruckt in: Niemöller, Wilhelm 1956: S. 79.)
Von daher erstaunt nicht, in welche Nähe zum NS-Staat sich die
evangelischen Kirchengemeinde in Duderstadt begab. Dazu seien zwei
Beispiele genannt:
Zum Erntedankfest 1933 veranstaltete die NSDAP auf dem Bückeberg
bei Hameln eine zentrale Feier mit Hitler als Redner. Dieses Ereignisses
wegen kündigte die evangelische Kirchengemeinde am 29.9.1933 an,
die Hauptfeier des Erntedanks müsse um eine Woche verschoben
werden, weil zu viele -Gemeindeangehörige und Mitglieder des
Kirchenchors der Einladung der NSDAP zum Bückeberg folgen wollten.
(Eichsfelder Morgenpost am 29.9.1933.) Aus dem Untereichsfeld fuhren
zwei Sonderzüge dorthin.
Das zweite Beispiel: Am 30. Januar 1934 beging die evangelische
Kirchengemeinde den ersten Jahrestag der „Machtergreifung“ mit einer
kirchlichen Feier. So steht es in einem Jahresrückblick von Pastor
Stünkel, den die Eichsfelder Morgenpost am 6.1.1935 veröffentlichte.
Mit einer solchen Feier bekannte sich die evangelische
Kirchengemeinde in einer wirklich besonderen Weise zum NS-Staat.
Die katholischen Bischöfe in Deutschland hatten bis zur Reichstagswahl
im März 1933 die Unvereinbarkeit christlicher Grundsätze mit der
nationalsozialistischen Ideologie hervorgehoben. Doch nun vollzogen
sie eine weitgehende Kehrtwende, die sie in der Kundgebung der
Fuldaer Bischofskonferenz vom 28. März 1933 erklärten. Der für
Duderstadt zuständige Hildesheimer Bischof verbreitete eine
Kurzfassung. Sein Hirtenwort druckte die Südhannoversche
Volkszeitung am 30.3.1933 im Wortlaut ab.
„Die Oberhirten der Diözesen Deutschlands haben aus triftigen Gründen
(…) in den letzten Jahren gegenüber der nationalsozialistischen
Bewegung eine ablehnende Haltung durch Verbote und Warnungen
eingenommen (…).
Es ist nunmehr a n z u e r k e n n e n , dass von dem höchsten
Vertreter der Reichsregierung, der zugleich autoritärer Führer jener
Bewegung ist, öffentlich und feierlich Erklärungen gegeben sind, durch
die der Unverletzlichkeit der katholischen Glaubenslehre und den
unveränderlichen Aufgaben und Rechten der Kirche Rechnung getragen
(…) wird. O h n e d i e i n
u n s e r e n f r ü h e r e n M a ß n a h m e n
l i e g e n d e V e r u r t e i l u n g b e s t i m m t e r
r e l i g i ö s – s i t t l i c h e r I r r t ü m e r
a u f z u h e b e n, glaubt daher der Episkopat das Vertrauen hegen zu
können, dass die vorbezeichneten allgemeinen Verbote und Warnungen
nicht mehr als notwendig betrachtet werden brauchen.
Für die katholischen Christen, denen die Stimme ihrer Kirche heilig ist,
bedarf es auch im gegenwärtigen Zeitpunkt keiner besonderen
Mahnung zur
T r e u e gegenüber der rechtmäßigen Obrigkeit und zur
gewissenhaften Erfüllung der staatsbürgerlichen Pflichten unter
grundsätzlicher Ablehnung alles rechtswidrigen und umstürzlerischen
Verhaltens. …“
Also kein Aufbegehren und Widerstand gegen den NS-Staat! Die statt
dessen geforderte Treue gegenüber der nunmehr
nationalsozialistischen Obrigkeit, und zwar unter Berufung auf die
heilige Stimme der Kirche, konnte im katholischen Duderstadt nicht
ohne Wirkung bleiben.
Der Duderstädter Stadtkaplan Thienel folgte den Vorgaben seines
Bischofs. Anfang April 1933 leitete er eine Versammlung des
Volksvereins für das katholische Deutschland. Ein Redner aus
Heiligenstadt stellte die Frage: Wie stehen wir Katholiken zum heutigen
Staat? Und er beantwortete sie laut Südhannoverscher Volkszeitung so:
„Wir Katholiken stellen uns hinter unseren großen Führer, unseren
Reichspräsidenten. Ebenso sind wir auch bereit, unseren (!) jetzigen
Reichskanzler alles nötige Vertrauen entgegenzubringen. (…) Wir
Katholiken geben daher dem Staate und seiner Führung, was dem (!)
Staate ist. Mitzuarbeiten an der Neuordnung des Volkes rufen wir jeden
auf. Mitschaffen wollen wir eine neue Kultur zum Wohle des deutschen
Volkes. Mitkämpfen wollen wir beim Aufbruch der Zeit.“
(Südhannoversche Volkszeitung am 11.4.1933.)
Im Juni 1933 betonte der Kaplan der gleichen Zeitung zufolge in einer
Festrede,
„der katholische Geselle stehe aus seiner Grundanschauung heraus
zum Staat. Er brauche es daher nicht besonders zu betonen, dass für
ihn die Achtung der staatlichen Autorität stets eine
Selbstverständlichkeit war. Solange Adolf Kolping sein großes Werk
ersann, haben seine Söhne, wie er es gewollt, sich stets und froh in den
Staat hineingestellt. So war es, so ist es und so soll es auch bleiben.“
(Südhannoversche Volkszeitung am 20. 6. 1933.)
Die gewiss mit Illusionen verbundene Hinwendung zum NS-Staats in
Duderstadt lässt sich auch in Zahlen ausdrücken. Am 12. November
1933 fand eine erneute Reichstagswahl statt. Dabei handelte es sich
keineswegs um eine demokratisch-freie Abstimmung, sondern um eine
Scheinwahl. Nur eine Partei kandidierte, die NSDAP. Der
Propagandaaufwand war gewaltig und reichte bis in die Wahllokale
hinein. Aber eines war doch gewährleistet: Die Wahl war geheim. Die
NSDAP erreichte unter diesen Umständen, also trotz der gegebenen
Möglichkeit zum Nein, in Duderstadt mehr als 90 Prozent der Stimmen.
Dieses hohe Maß an Befürwortung muss man im Zusammenhang
sehen mit dem, was als erste Erfolge der Hitler’schen Politik verstanden
wurde, sowie mit der Sogwirkung der propagandistischen
Beeinflussung. Hinzu kam in Duderstadt die beschriebene Intervention
der Kirchen. Ein Detail verdient besondererer Aufmerksamkeit. 92,2
Prozent der Stimmen erreichten die Nationalsozialisten reichsweit. In
Duderstadt waren es 92,3 Prozent. Hatte bei der Reichstagswahl im
März die NSDAP in Duderstadt noch deutlich hinter dem
Gesamtergebnis der Partei zurück gelegen, so übertraf sie dieses jetzt
sogar, wenn auch nur geringfügig um 0,1 Prozent. Die Zustimmung zur
NSDAP war in Duderstadt also nicht mehr geringer als anderswo. Ein
politischer Stimmungsumschwung bedeutenden Ausmaßes hatte binnen
weniger Monate stattgefunden.
Diese Wahlanalyse findet ihre Absicherung in den Erkenntnissen der
historischen Forschung heute. Ich zitiere Norbert Frei: „Nur wenige
Monate nach der ‚Machtergreifung’ taten eine suggestive Propaganda,
erste beschäftigungspolitische Erfolge und außenpolitische
Machtdemonstrationen bereits ihre Wirkung. Sie sorgten – stärker als
der polizeistaatliche Terror – dafür, dass die Bereitschaft wuchs, sich
dem Zug der ‚neuen Zeit’ anzuschließen – oder doch das Gefühl, sich
dem nicht mehr entgegenstellen zu sollen. Das galt auch für jene,
gegen deren politische Überzeugungen und Interessen das Regime
explizit angetreten war.“ Und Frei fügte hinzu, es sei offensichtlich
heute immer noch schwer, „mit dem Eingeständnis zu leben, dass sich
seinerzeit fast die gesamte deutsche Nation mit Hitler und seinen Zielen
identifizierte, in hohem Maße sogar mit seiner Politik gegenüber den
Juden“ .
Literatur:
Frei, Norbert: 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der
Deutschen, München 2009.
Niemöller, Wilhelm: Die Evangelische Kirche im Dritten Reich.
Handbuch des Kirchenkampfes, Bielefeld 1956, S. 79.
Röhrbein, Waldemar R.: Gleichschaltung und Widerstand in der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 1933 – 1935. In:
Grosse, Heinrich/Otte, Hans/ Perels, Joachim (1996).

Themen:
NS-Zwangsarbeit
- Zwangsarbeiterkind
in Duderstadt
KZ-Außenlager
Jüdische Gemeinde:
- Geschichte
- jüdischer Friedhof
- Friedhof 1953
- Vernichtung
- Stolpersteine
Nationalsozialismus
und Duderstadt
- Verdrängte Realität
- Bgm. Dornieden
- Richter Trümper
- Priester R. Kleine
Nachgeschichte des
Nationalsozialismus:
- bürgerliche Alt-Nazis
- Kriegsgräber
- Anreischke
- Rechtsextremismus
Friedensglobus
Kriegsgefangene
Hinweis:
Die
Geschichtswerkstatt
Duderstadt e.V.
wurde vom
Finanzamt Northeim
als gemeinnützig
anerkannt und kann
Spendenquittungen
ausstellen.
Bankverbindung der
Geschichtswerkstatt:
Sparkasse
Duderstadt (BLZ
26051260), Konto
Nummer 116830