



Geschichte der Synagogengemeinde Duderstadt 1812 – 1942
Vortrag von Götz Hütt (2011)
Noch ist die Geschichte der neuzeitlichen Synagogengemeinde in Duderstadt – es gab zuvor schon
einmal eine im Mittelalter – nicht umfassend erforscht und dargestellt; dieser Vortrag ist deshalb
auch bescheidener „Zur Geschichte der Synagogen-Gemeinde Duderstadt 1812 bis 1932“ genannt.
Quellen sind dabei Archivalien im Stadtarchiv Duderstadt und im Hauptstaatsarchiv Hannover,
somit das, was über die Synagogen-Gemeinde in Akten verschiedener Ämter seinen Niederschlag
gefunden hat. D. h., der uns mögliche Blick auf die jüdische Gemeinde ist auf das beschränkt, was
früher ein amtliches Interesse fand.
Dieser Mangel des begrenzten Zugangs zur Geschichte der Juden in Duderstadt ist aber nicht
behebbar. Und doch ist das Vorhandene so umfang- und inhaltsreich, dass sich eine Beschäftigung
damit lohnt und dass wir uns auf eine strenge Auswahl des Darbietbaren beschränken müssen.
Die jüdische Synagoge in Duderstadt. Davor vermutlich die
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrer der jüdischen Volksschule.
(Foto: Stadtarchiv Duderstadt)
Niederlassung, Gründung der Synagogen-Gemeinde und erste Emanzipation
Ein Bericht des Duderstädter Bürgermeisters Jordan an die Königliche Landdrostei Hildesheim –
wir würden sagen: an den Regierungspräsidenten – kann uns zurückversetzen in das 19.
Jahrhundert. Zur Vorgeschichte dieses Berichts ist zu erwähnen, dass am 7. Oktober 1853 Samuel
Levy im Duderstädter Rathaus erschien. Levy war Einwohner von Duderstadt mit dem Status eines
„Schutzverwandten“, d. h., er besaß ein Wohnrecht in der Stadt und die Konzession, hier seinem
Gewerbe nachzugehen. Aber er war nicht Bürger der Stadt. Und dieses Bürgerrecht wollte er jetzt
beantragen. Aber das Bürgervorsteher-Kollegium, sozusagen der Stadtrat, stimmte einstimmig
gegen sein Gesuch. Auch von zwei der drei Senatoren wurde es abgelehnt. Levy legte Widerspruch
ein. Nun musste die höheren Instanz, eben die Königlichen Landdrostei, entscheiden. Ihr musste
deshalb Bürgermeister Jordan Bericht erstatten. Aus diesem Bericht zitieren wir jetzt einige
Passagen, um sie anschließend noch etwas zu erläutern und weiter daran anzuknüpfen. Zugleich
setzten wir damit Sie als Zuhörer der uns heute etwas ungewöhnlich klingenden Amtssprache jener
Zeit aus. Vorab gleich eine erste Erklärung: Mit dem „Recurrenten“ ist der Beschwerde einlegende
Levy gemeint.
„Der Vater des Recurrenten Michael Nathan Levy zog 1812 also zu westphälischer Zeit mit seiner
Familie von Wöllmarshausen vormal[iges] Gericht Altengleichen nach Duderstadt u. nährte sich
hier als Metzger und Lotterie-Collateur, nachdem er als hiesiger Einwohner recipiert war, musste
aber am 13. July 1818 nach höherer Vorschrift einen Schutzbrief für die Stadt Duderstadt zum
Aufenthalt u bisherigen Geschäftsbetriebe daselbst (…) erwirken, damit in das Schutzverhältnis
treten u seitdem an die Kg. Rentei ein jährl[iches] Schutzgeld von 4 Thalern und an die Cämmerei-
Casse eine jährliche Abgabe von 1 Thaler für temporairen Aufenthalt entrichten.
Recurrent zog schon mit seinen Eltern nach hies. Stadt und erhielt, als er sich selbständig ansetzen
wollte am 27 März 1835 den eingeführten Schutz, nachdem sein Vater zu seinen Gunsten darauf
verzichtet hatte unter Auferlegung der von seinem Vater bislang gezahlten Abgaben (…), besetzte
sich als Lotterie Collateur mit zwei Gehülfen in Gemäßheit einer ihm am 9 März 1836 von
hiesigem Magistrate ertheilten Concession, verheiratete sich, ernährte sich durch die Lotterie-
Collection u Handel mit Brennholz u Hafer, ist seit 1842 Vorsteher der hiesigen Synagogen
Gemeinde, erhielt dann, da keine öffentliche Leihanstalt allhier existierte (…) am 21 Juni 1850 von
hies. Magistrate die Concession zur Errichtung eines Pfandleihgeschäfts (…).“ [1]
Bürgermeister Jordan stellte dann dar, wie die Mehrheit in den städtischen Gremien ihren
ablehnenden Beschluss begründet hatte:
„Es muß nämlich bedenklich erscheinen, dem Petenten das Bürgerrecht zu ertheilen, da bislang ein
Israelit als Bürger hiesiger Stadt nicht angenommen ist, der erste Fall unzweifelhaft viele folgende
nach sich ziehen wird u bei dem speculativen Geschäftsbetriebe der Israeliten, welchen kein
Gewinn zu gering ist und jedes Geschäft ansteht, dem Gewerbebetriebe der christlichen
Einwohnerschaft (…) wesentliche Nachtheile entstehen dürften; (…) durch die Ertheilung des
Bürgerrechts würde er [Levy] aber erst der Gemeinde angehörig werden, denn er stand bislang im
Schutzverhältnis u der hiesigen Gemeinde gegenüber befand er sich ganz in der Lage eines
Fremden, welcher für temporairen Aufenthalt in hies. Stadt eine Abgabe an die Gemeinde-Casse
zahlt.“ [2]
Diesen und weiteren Argumenten stellte Jordan seine eigene Auffassung entgegen, dass es sich
nämlich bei dem „Recurrenten nicht um Zulassung eines neuen Gemeindemitgliedes, sondern um
Gewährung eines Rechtes handelt, welches den hiesigen christlichen Schutzverwandten von
tadellosem Wandel nicht vorenthalten ist u füglich [dem Levy] nicht vorenthalten werden kann; (…)
daher ist denn auch der Glaube offenbar der Grund der Verweigerung. (…) Die Verweigerung des
vom Recurrenten nachgesuchten Bürgerrechts drängt ihn offenbar in den früheren rechtlosen
Zustand der Juden zurück, obgleich wir selbst uns der Ansicht zuneigen müssten, dass der Jude
nach jetziger Gesetzgebung zu allen Gemeindewahlen, ja Gemeindeämtern berechtigt u befähigt zu
halten sei …“. [3]
Bürgermeister Jordan hatte an den Anfang seines Berichts einen historischen Rückblick gestellt, der
noch zu ergänzen ist. Während Duderstadt bis 1802 dem Mainzer Kirchenstaat angehörte, war
Juden nicht erlaubt, sie hier niederzulassen. Das änderte sich erst mit der Zugehörigkeit Duderstadts
zum Königreich Westfalen, jenem kurzlebigen Staat unter Napoleons Bruder Jérome. Im
Königreich Westfalen erhielten Juden 1808 nach dem Vorbild des revolutionären Frankreich die
vollständige staatsbürgerliche Gleichberechtigung. Ebenso stand ihnen eine vollkommene
Niederlassungs- und Berufsfreiheit zu. Das erst ermöglichte Michael Levy, dem Vater Samuel
Levys, 1812 mit seiner Familie nach Duderstadt zu ziehen, eine Chance, die auch vier weitere
Familien aus Wöllmarshausen und Witzenhausen nutzten.
Nach Ende der napoleonischen Zeit betrieb die Stadt 1816 die Ausweisung ihrer neuen jüdischen
Bürger. Das gelang nicht, jedoch verloren die Juden in Duderstadt ihr Bürgerrecht und wurden in
den Status von Schutzjuden zurückversetzt. Sie waren, jeweils auf 12 Monate befristet, dem Schutz
der Landesherrschaft unterstellt und mussten für ihr Wohn- und Gewerberecht ein Schutzgeld
zahlen, 4 Reichstaler an die Staatskasse und einen an die städtische Kämmerei. Dieser Schutz
wurde von Jahr zu Jahr verlängert. Ein weiterer Zuzug von Juden nach Duderstadt wurde allerdings
verhindert. Wie restriktiv die Zulassung von Juden geregelt wurde, wird für uns in dem zitierten
Bericht des Bürgermeisters Jordan daran erkennbar, dass selbst die Kinder von hiesigen Juden kein
Recht erhielten, sich in Duderstadt niederzulassen, es sei denn, der Vater verzichtete zugunsten des
Sohnes auf sein Schutzrecht.
Eine rechtliche Verbesserung brachte im Königreich Hannover das Gesetz über die
Rechtsverhältnisse der Juden aus dem Jahre 1842. Die Juden in der Stadt waren seither nicht mehr
Schutzjuden, sondern „Schutzverwandte“, die weitere Rechte erwerben konnten. Die Königliche
Landdrostei entschied daher in dem Widerspruchsverfahren zugunsten des Gesuchs von Levy, und
so erhielt dieser am 29. März 1854 die Aufforderung, sich demnächst zu seiner Einbürgerung im
Rathaus einzufinden:
„In Gemäßheit Rescr[iptes] K[öniglicher] Landdrostei zu Hildesheim v. 22/25 d M. eröffnen wir
Ihnen hiermit, dass Ihnen gegen Erlegung von 20 Thaler Courant an die Cämmerei Casse und die
Kosten das Bürgerrecht hiesiger Stadt ertheilt werden soll. Zu Ihrer eidlichen Verpflichtung haben
Sie sich montags oder donnerstags morgens zwischen 11 u. 12 Uhr auf hiesigem Rathhause
einzufinden und behuf Vornahme der Handlung zu diesem Termine einen Rabbiner oder jüdischen
Religionslehrer zu sistiren auch ein hebräisches Exemplar der 5 Bücher Mosis mit zur Stelle zu
bringen.“ [4]
Bürgermeister Jordan hatte in seinem Bericht auch erwähnt, dass Levy Vorsteher der Synagogen-
Gemeinde in Duderstadt war. Zu einer solchen Gemeinde mit Israel Stern als Vorsitzendem waren
die jüdischen Einwohner Duderstadts bereits in der ersten Hälfte der 20er Jahre des 19.
Jahrhunderts zusammengeschlossen. Dies ist aktenkundig geworden, weil die jüdische Gemeinde
Samuel Grünthal zu helfen versuchte. Grünthal lebte bereits seit Jahren in Duderstadt und war als
Gehilfe einem jüdischen Geschäft angestellt. Er war – wie es damals hieß – ein unvergleiteter, d. h.
nicht mit einem Schutzbrief versehener Jude. Obwohl unbescholten, wurde er mit Strafandrohung
aufgefordert, Duderstadt binnen Kurzem zu verlassen. Um seine Chancen für ein Bleiberecht zu
erhöhen, stellte ihn die jüdische Gemeinde kurzerhand als Synagogendiener ein. Der dazu
geschlossene Vertrag enthält für uns einige Informationen über die Verhältnisse in der jüdischen
Gemeinde, z. B. darüber, wie sehr sie sich darum bemühen musste, dass bei einem Gottesdienst
auch die vorgeschriebene Zahl von mindestens 10 männlichen Teilnehmern ab 13 Jahren erreicht
wurde.
„Es hat die hiesige Israelitische Gemeinde vom heutigen Tage an den Salomon Grünthal als Ihren
Synagoge Diener dergestalt angenommen, das der selbe alle zu diesem Dienste nöthige Arbeit
völlig und unverdroßen leistet, als nehmlich 1tens die Gemeinde Gelder zur gehörigen Zeit
eincassirt u. selbe an Vorsteher abzuliefern, 2tens die Synagoge in Ordnung zu erhalten als beym
Gottesdienst die Lichter zu besorgen. 3tens wenn es sich ereignet, dass Kranke von unseren
Glaubensgenoßen hier kommen sollten, so muß der selbe dafür sorgen dass selbe by unseren
glaubens Genoßen gespeist und verpflegt werden. 4tens Wenn Gottesdienst gehalten werden soll, so
muß es derselbe an jedes mitglied der Gemeinde bekannt machen. Im Fall einer oder der Andere
unserer Gemeinde Abwesend sein sollte, so muß derselbe dafür sorgen das an seiner Stelle ein
anderer von einem anderen Orte bestellt wird, das der Gottesdienst gehalten werden kann. Zu
diesem Dienst haben wir den Salomon Grünthal von heute auf ein Jahr angenommen, wofür
derselbe für dieses Jahr 30 Thaler aus der Israelitische Gemeinde Casse erhält (…).“ [5]
Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Juden aus dem Jahr 1842 brachte den Juden nicht nur
mehr Rechtssicherheit, sondern auch wesentliche Veränderungen für die jüdischen Gemeinden.
Jeder Jude musste fortan einer Synagogen-Gemeinde angehören. Wenn die Zahl der in einem Orte
wohnenden Juden für die Bildung einer solchen Gemeinde nicht ausreichte, wurden die jüdischen
Einwohner mehrerer Ortschaften zu einem Synagogenverband zusammengeschlossen.
Am 18.12.1843 verfügte die Königliche Landdrostei, es sei ein Synagogenverband Duderstadt –
Ebergötzen – Rüdershausen zu bilden. Die Einrichtung dieser jüdischen Gemeinde wurde also
staatlich verordnet. Unter Federführung des Duderstädter Magistrats wählten die stimmberechtigten
Gemeindemitglieder am 12. April 1844 um 10 Uhr vormittags Samuel Levy, den wir schon aus dem
Bericht von Bürgermeister Jordan kennen, zum Gemeindevorsteher. – Die Amtszeit des
Synagogenvorstehers betrug jeweils 3 Jahre. Nach seiner Wahl wurde er jeweils vom Magistrat der
Stadt auf ihr Amt vereidigt.
Wie weit der Staat in die jüdischen Gemeinde hineinregierte, zeigte sich auch bei der Vorsteherwahl
1868. Vier Stimmen entfielen auf Moritz Katz aus Duderstadt und vier auf den bisherigen
Amtsinhaber Abraham Rosenbaum aus Ebergötzen. Wegen der Stimmengleichheit stand dem
städtischen Magistrat der Stichentscheid zu. Die Wahl des Magistrats Wahl auf Moritz Katz. Als
Abraham Rosenbaum die Amtsunterlagen weiterreichte, fehlte eine Kasse ebenso wie eine
Buchführung. Der Grund dafür war aber ganz banal: Die Gemeinde verfügte weder über
Einnahmen, noch hatte sie Ausgaben zu tätigen. Es gab nichts zu verbuchen: Eine Synagoge besaß
die Gemeinde nicht, es wirkte in ihr auch kein Rabbiner. Eine Schule war nicht zu unterhalten und
kein Lehrer zu besolden. Eine Armenkasse gab es nicht. In Duderstadt existierte nicht einmal das,
was man einen jüdischen Friedhof nennen könnte. Die jüdische Gemeinde gab also 1868 ein
reichlich armseliges Bild ab.
Doch etwa in dieser Zeit setzte ein erheblicher Zuzug von Juden nach Duderstadt ein. Das hatte mit
der 1869 durch den Norddeutschen Bund eingeführten rechtlichen Gleichstellung der Juden, also
mit gewonnener Freizügigkeit ebenso zu tun wie mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der
besseren Möglichkeit geschäftlicher Betätigung in der Stadt. 1867 lebten 16 Juden in Duderstadt,
1871 waren es bereits 29. Die wachsende jüdische Gemeinde in Duderstadt begann, die kulturellen
Einrichtungen zu schaffen, die sie benötigte. Das führte zu Auseinandersetzungen mit den
Gemeindemitgliedern in Ebergötzen. Die wollten mit ihren finanziellen Beiträgen zur
Synagogengemeinde nicht für Einrichtungen in Duderstadt herangezogen werden, von denen sie
wegen der Entfernung selbst keinen Nutzen hatten. Diesen heftigen Streit wollen wir hier aber nicht
verfolgen, nur den Hinweis geben, dass 1872 auf Vorschlag des vermittelnden Landrabbiners bei
formaler Erhaltung des Synagogenverbandes eine weitgehende Trennung der Juden in Ebergötzen
und Duderstadt voneinander erfolgte, ohne dass dieser Kompromiss eine dauerhafte Lösung des
Konflikts bedeutete. Wir wenden uns dem jüdischen Friedhof, der jüdischen Schule und der
Synagoge in Duderstadt zu.
Der jüdische Friedhof
Was die Bestattung der in Duderstadt gestorbenen Juden anbelangte, so wies der Vorsteher der
jüdischen Gemeinde in Duderstadt, Moritz Katz, den „Wohllöblichen Magistrat“ am 8. März 1870
schriftlich auf einen Missstand hin. Der jüdischen Gemeinde war zu einem heute unbekannten
Zeitpunkt für die Beerdigung ihrer Toten eine städtische Viehweide zugewiesen worden, im Bereich
des Sulbigbaches, etwa dort, wo sich jetzt der jüdische Friedhof am Gänseweg befindet. Katz
schrieb:
„Der Begräbnißplatz … entbehrt bislang einer Einfriedung, so daß er allem Vieh zugänglich, sogar
ausdrücklich damit behütet wird. Wenn schon im Allgemeinen die Pietät gegen Verstorbene
gebietet, die Begräbnißstätten in Ehren zu halten, so muß es gewiß für deren Angehörigen
schmerzlich sein zu sehen, wie ihre Gräber durch Behütung jeglichen Viehes entweihet werden.
Mehrfach ergangene Regierungsverordnungen verlangen deshalb auch auf das Bestimmteste, dass
die Begräbnißplätze eingehegt, gut im Stande erhalten und Entweihungen durch Einlaufen des
Viehes verhütet werden.
Unser Begräbnisplatz gleicht leider nur einem wüsten Orte, welcher durchaus nicht von Achtung
gegen die dort Ruhenden, wie es die religiöse Pflicht gebietet, zeugt.
Eine Schmückung der Gräber durch die Angehörigen kann nicht vorgenommen werden, weil über
kurz oder lang die (…) weidenden Heerden doch alles zerstören würden. Als Vorsteher der hiesigen
jüdischen Gemeinde sehe ich mich auf specielle Veranlassung (meiner?) Glaubensangehörigen
unter den obwaltenden beklagenswerten Umständen genöthigt, wohllöblichen Magistrat hiermit
gehorsamst zu bitten, (…) baldmöglichst die uns überwiesene Begräbnißstätte einfriedigen zu
lassen und jegliche Behütung derselben mit Vieh strengstens sofort verbieten zu wollen. Wir
glauben zu dieser Bitte schon um deswillen berechtigt zu sein, weil der Begräbnißplatz der
christlichen Confessionen gleichfalls aus der städtischen Cämmereicasse beschafft, erhalten und
eingefriedigt wird.
Da wir gleich den christlichen Confessionen hierorts gegen den Magistrat dieselben Pflichten
haben, so stehen uns selbstredend auch dieselben Rechte zu.“ [6]
Der von Katz beklagte Missstand lässt ein erhebliches Maß an Antisemitismus im damaligen
Duderstadt erkennen. Dagegen hatte sich offenbar bis dahin die lange Zeit kleine jüdische
Gemeinde nicht zur Wehr setzen können. Jetzt fällt auf, wie Katz neben der Änderung der
unwürdigen Verhältnisse nachdrücklich eine Gleichstellung der Juden mit den christlichen
Einwohnern verlangte, deren Friedhof von der Stadt unterhalten wurde. Durch die Eingabe von
Katz sahen sich die Bürgervorsteher zum Handeln veranlasst. Sie entschieden, der jüdischen
Gemeinde auf der Weide eine Fläche von 4 bis 5 Quadratruten, das sind etwa 120 bis 150
Quadratmeter für einen Friedhof zu übertragen und außerdem einen Zuschuss in Höhe von 25
Talern zu seiner Einrichtung zu gewähren. An der Unterhaltung des jüdischen Friedhofs wollte die
Stadt sich aber nicht beteiligen.
Mit der Ausführung dieses Beschlusses ließ man sich jedoch Zeit. Erst ein Jahr später, im März
1871, fand ein Ortstermin statt. Der ergab, dass die Gräber nicht mehr alle sichtbar vorhanden und
nicht alle beisammen angelegt waren, sondern dass auch von „einigen vielleicht in entfernten
Winkeln liegenden Leichen“ [7] ausgegangen werden musste. Die Fläche wurde auf etwa 180
Quadratmeter erhöht und die Grenzen des künftigen jüdischen Friedhofs wurden so abgesteckt, dass
wenigstens die sichtbar vorhandenen Gräber mit eingefriedet wurden. Am 31. Juli 1871 bat dann
Katz den Magistrat, den bewilligten Zuschuss in Höhe von 25 Talern an den Maurermeister Mühlau
zu überweisen, da er die Einfriedigung des Friedhofes beendet habe. – Eine würdige Beerdigung
ihrer Toten war damit den Juden in Duderstadt ermöglicht, aber nicht ihre Gleichbehandlung mit
den christlichen Einwohnern der Stadt erreicht.
Die jüdische Elementarschule
Der Anstoß zu dem Versuch, eine jüdische Schule in Duderstadt einzurichten, ging von der
Schulordnung für die jüdischen Schulen des Königreichs Hannover aus, die 1854 erlassen wurde.
Die Schulordnung bestimmte, dass jede Synagogengemeinde einen Schulverband zu bilden und
eine jüdische Elementarschule – also Volksschule – , zumindest aber eine Religionsschule
einzurichten habe.
Wie ernst es dem Staat mit der religiösen Erziehung der Kinder war, drückte sich in der Vorschrift
aus, jüdische Kinder hätten in Zukunft bei ihrem Eintritt in das bürgerliche Leben nachzuweisen,
genügenden Unterricht in ihrer Religion genossen zu haben. Was unter genügendem Unterricht in
jüdischer Religion verstanden wurde, ist den Bestimmungen zum Lehrplan zu entnehmen:
㤠32
In den jüdischen Elementarschulen sollen wöchentlich wenigstens drei und dreißig Stunden
Unterricht ertheilt und mindestens elf Stunden auf die Religionsgegenstände verwendet werden. …
§ 33
Der Unterricht in den jüdischen Religionsschulen umfasst folgende Lehrgegenstände:
1.
hebräisch Lesen und Schreiben
2.
hebräische Sprache und Gebete, sowie die Übersetzung derselben,
3.
Übersetzung und Erklärung der heiligen Schrift,
4.
hebräische Grammatik,
5.
biblische und jüdische Geschichte,
6.
systematische Religionslehre, und wo thunlich
7.
rabbinische Schriften und Gesang.
§ 34
In jüdischen Elementarschulen kommen zu diesen Gegenständen noch Deutsch Lesen und
Schreiben, deutsche Sprache, Rechnen, Geographie, Geschichte, Naturkunde, sowie Denk- und
Sprechübungen.“ [8]
Aber der Versuch, gleich 1854 auf Betreiben des städtischen Magistrats, eine Religionsschule für
die 6 schulpflichtigen jüdischen Kinder in Duderstadt, Ebergötzen und Rüderhausen einzurichten
schlug fehl. Der Synagogenverband wollte oder konnte nur den in der Schulordnung vorgesehenen,
aber erklärtermaßen völlig unzureichenden Mindestlohn für den Lehrer aufbringen und fand bei
bestehendem Lehrermangel keinen. Erst 1872 konnte eine jüdische Schule in Duderstadt gegründet
werden.
„Vertrag
Zwischen der Synagogen-Gemeinde Duderstadt und dem Lehrer Joseph Strauß aus Eschau ist heute
am 3. März 1872 nachstehender Contract abgeschlossen worden.
1.
Die Synagogen-Gemeinde Duderstadt überträgt dem Lehrer Joseph Strauß aus
Eschau die Lehrer, Vorbeter und Schächterstelle mit einer jährlichen Besoldung
von 200 Thaler.
2.
Das Gehalt des Lehrers Strauß ist vierteljährig bei dem Vorstande der Synagogen-
Gemeinde zu erheben.
3.
Das Schächtergeld wird besonders gezahlt und kann nicht zur Besoldung
geschlagen werden.
4.
der Lehrer Strauß verpflichtet sich, die jüdischen Kinder der Gemeinde in allen
von den Gesetzen und den Ausführungsvorschriften vorgeschriebenen
Elementarunterrichtsgegenständen sowie in der hebräischen Sprache und der
Religion pflichtmäßig zu unterrichten und alle Pflichten seines Amtes pünktlich
und gewissenhaft zu erfüllen.
5.
Das Engagement des Lehrers Strauß beginnt am 1. März 1872 und kann dasselbe
bis zum 1. April 1873 nicht aufgehoben werden.“ [9]
Über die Regelungen für die Nebeneinnahmen der jüdischen Lehrer gibt der Vertrag mit dem
Nachfolger von Joseph Strauß, nämlich mit Simon Cohnhoff Auskunft: Als Vorbeter konnte er bei
Beschneidungen oder Namensbeilegungen mindestens 3 Mark, bei der Religionsweihe mindestens
6 Mark beanspruchen. Das Schächtergeld betrug:
für großes Rindvieh je Stück 1,50 Mark,
für kleines Rindvieh je Stück 0,25 Mark,
für Geflügel je Stück 0,10 Mark.
Die jüdische Elementarschule in Duderstadt wurde aber auch mehrfach in Frage gestellt. Zum
Beispiel 1993 richtete die Bezirksregierung folgende Anfrage an den Magistrat:
„Den Magistrat ersuchen wir ergebenst, uns zu der Frage, ob die nur von wenigen Kindern besuchte
jüdische Volksschule dortselbst über kurz oder lang wird aufgelöst werden können, gefälligst zu
berichten, welche Verhältnisse die Errichtung der in Rede stehenden kleinen erklären und etwa ihr
Fortbestehen besonders wünschenswerth machen, eventuell in welcher Weise für das
Unterrichtsbedürfniß der zur Zeit dort eingeschulten Kinder anderweit gesorgt werden könnte.“ [10]
Der Magistrat antwortete auf eine sehr aufschlussreiche Weise:
„Das Volksschulwesen in der Provinz Hannover ist confessionell, und würden wir keinen Grund
haben, das Eingehen der jüdischen Schule, zu deren Erhaltung die hiesigen Juden gesetzlich
verpflichtet sind, zu fördern. In den hiesigen katholischen und lutherischen christlichen
Volksschulen für das Unterrichtsbedürfnis der schulpflichtigen Judenkinder zu sorgen wird schwer
angängig sein, da beide Confessionsschulen keine Neigung haben, die dahier immer weiter
heranwachsende Zahl der schulpflichtigen Judenkinder bei sich aufzunehmen." [11]
Der Magistrat sieht aber nicht einen Raummangel oder einen Lehrermangel als Hinderungsgrund.
Die jüdische Schule war wirklich sehr klein und wurde z. B. 1897 von 6 Kindern besucht. Die
fehlende Neigung war Abneigung gegenüber Juden. Antisemitisch begründete Ausgrenzung half so,
die jüdische Zwergschule in Duderstadt zu erhalten.
Der Beitrag, den die jüdischen Einwohner Duderstadts zur Synagogengemeinde leisten mussten,
war nicht zuletzt wegen der Kosten der Schule sehr hoch. Er entsprach nahezu der staatlichen
Einkommensteuer, welche sie zu entrichten hatten. So ist es nicht verwunderlich, dass die jüdische
Gemeinde nach Entlastung suchte. 1901 beantrage sie erstmals, „die bestehende israelitische
Volksschule gleich der katholischen und evangelischen Volksschule mit auf städtischen Etat zu
übernehmen“. [12] Aber erst für das Schuljahr 1908/1909 bewilligte der Magistrat einen jährlichen
Zuschuss in Höhe von 24 Mark für jedes Kind der jüdischen Volksschule, der jedoch weit unter den
Kosten für jedes Kind dieser Schule lag.
Durch den gewährten Zuschuss hatte die Synagogengemeinde zwar eine Verbesserung ihrer
finanziellen Situation erreicht, aber – ähnlich wie früher beim jüdischen Friedhof – nicht die
Gleichstellung, dass der Lehrer der jüdischen Volksschule wie die Lehrer der christlich-
konfessionellen Schulen aus dem städtischen Etat besoldet wurde. 1924 wurde die jüdische Schule
durch die Bezirksregierung Hildesheim geschlossen und deren einziger Schüler angewiesen, eine
entsprechende städtische Schule zu besuchen. Der letzte jüdische Lehrer, Louis Kamm, wurde in
den einstweiligen Ruhestand versetzt und zog nach Hannover.
Die Schließung der Schule bedeutete damit auch in anderer Hinsicht einen schweren Verlust für die
Synagogengemeinde, denn mit dem Lehrer verlor sie zugleich ihren Vorbeter.
Die Synagoge
Nachdem es jahrzehntelang in Duderstadt keine Synagoge mehr gegeben hatte und keine
Gottesdienste gefeiert worden waren, mietete die jüdische Gemeinde 1871 einen kleinen Saal im 3.
Stockwerk des Haus Marktstraße Nr. 34 an, das dem Zigarrenfabrikanten Moses Löwenthal gehörte.
(Heute: Filiale von „Ihr Platz“.) Über diesen damals auch als „Tempel“ bezeichneten Raum und
über seine Nutzung erfahren wir ein wenig wegen einer Beschwerde. Jacob Esberg, Mitglied der
Synagogengemeinde, hatte sich Hilfe suchend an den Magistrat der Stadt Duderstadt gewandt.
„Duderstadt, den 20. Juli 1886
An den Wohllöblichen Magistrat zu Duderstadt
Unterzeichneter bittet den Wohllöblichen Magistrat ergebenst, dem Uebelstande, dass die Fenster in
der Synagoge während des Gottesdienstes geschlossen werden, abzuhelfen und anzuordnen, dass die
Fenster während des Gottesdienstes namentlich bei starker Hitze geöffnet werden. Die Synagoge,
welche eine Länge von 8,59 Meter, eine Breite von 7,70 Meter und nur eine Höhe von 2,61 Meter hat,
wird in der Regel von 50 bis 60 Personen auf 1 ½ bis 2 Stunden besucht.
Wie der Herr Kreisphysikus hier begutachten wird, ist der Aufenthalt in der vorgedachten,
beschränkten Synagoge bei starker Hitze und der angegebenen Zahl der Besucher, ohne dass die
Fenster geöffnet werden, ein unerträglicher.
Ergebenst
Jacob Esberg“ [13]
Es blieb aber nach einer gutachterlichen Stellungnahme des Stadtphysikus, also des Amtsarztes,
dabei, dass die Fenster während des Gottesdienstes geschlossen blieben.
Warum diese Regelung galt, ob aus dem Synagogensaal nichts heraus- bzw. aus der Marktstraße
nichts in ihn hineindringen sollte, wird in den Akten nicht erwähnt.
Am 24. Januar 1995 stand in der Versammlung der Synagogengemeinde nicht nur die turnusmäßige
Wahl des Vorstandes, sondern erstmals der „Tempelbau“ auf der Tagesordnung. Der gemietete
Raum in der Marktstraße genügte den Ansprüchen nicht mehr. Daher wurde der wiedergewählte
Vorsteher Moritz Katz ermächtigt, das Gemeindehaus zu verkaufen. Der Erlös sollte als finanzieller
Grundstock für den Bau einer Synagoge dienen.
Bei diesem Gemeindehaus handelte es sich um das Gebäude Nr. 33 in der Steintorstraße, in dem
sich heute die Bäckerei Vieth befindet. In diesem Haus war die jüdische Volksschule untergebracht
und es wohnte dort auch der Lehrer Simon Cohnhoff. Vorsteher Katz verkaufte das Gemeindehaus
für 8000 Mark zum 1. Mai 1895 [14] an den Bäckermeister Theodor Hackethal. Diesem wurde
dabei vertraglich zugesichert, „mit dem Bau seines Ofens im Schulzimmer schon am 15. April 1895
zu beginnen“.[15] Seitdem befindet sich also dort eine Bäckerei. Die kleine Schar der jüdischen
Schülerinnen und Schüler sollte vorerst in der Wohnstube des Lehrers unterrichtet werden.
Nun war damals die Synagogengemeinde aber keineswegs frei, nach eigenem Ermessen über ihren
Besitz zu verfügen. In der autoritären Monarchie bedurfte sie dazu einer Genehmigung der
staatlichen Behörden. Am 12. Februar 1895 reichte sie ein entsprechendes Gesuch ein. Der
Magistrat in Duderstadt erhob keine grundsätzlichen Einwände gegen den Verkauf und die
Bezirksregierung stimmte zu.
Die Suche nach einem geeigneten Grundstück gestaltete sich schwierig, nicht zuletzt deshalb, weil
der bis dahin grundsätzlich wohlwollende Duderstädter Magistrat sich eine Synagoge nicht im
Stadtzentrum, nicht in der Nachbarschaft wichtiger kommunaler oder kirchlicher Einrichtungen
vorstellen konnte. Es begann etwas, was uns heute ähnlich aus manchen Städten bekannt wird,
wenn dort eine Moschee gebaut werden soll.
„Duderstadt d. 22. Februar 1895
An den
Wohllöblichen Magistrat
Hier
(…)
Nachdem die hiesige Synagogengemeinde das ihr gehörige vor dem Steintor belegene Wohnhaus
hat verkaufen müssen, da es sich zum Bau einer Synagoge nicht eignete, gestatte ich mir,
Wohllöblichem Magistrat die unterthänigste Bitte zu unterbreiten, der Gemeinde den freien Platz
hinter dem Rathhause zu diesem Zweck zu überlassen. Der Platz, welcher der Stadt doch wohl
nichts einbringen dürfte, ist groß genug und so belegen, dass die Synagoge, nach Osten gelegen,
darauf gebaut werden kann.
Ich kann schon jetzt versprechen, dass die Gemeinde, so weit es in ihren Kräften steht, bemüht sein
wird, den Bau so zu gestalten, dass er zur Zierde der Stadt mit beitragen wird.
Einer bald gefl. geneigten Antwort entgegen sehend
Verharre
Wohllöblichem Magistrat gehorsamster
M. Katz“ [16]
Dieses Gesuch wurde umgehend ohne Begründung abgelehnt. Im Frühjahr 1896 gelang es der
jüdischen Gemeinde, ein Grundstück in der Gartenstraße, der heutigen Christian-Blank-Straße, für
ihr Bauvorhaben zu erwerben. Dieser Kauf musste wieder von der Bezirksregierung genehmigt
werden. Der Duderstädter Magistrat intervenierte beim Regierungspräsidenten, um diese
Genehmigung zu verhindern. Bürgermeister Machens schrieb:
Wir halten „das Grundstück nicht geeignet zum Bau einer jüdischen Schule und Synagoge.“
Dieser Feststellung folgte ein ausführlicher Begründungsversuch. Das Grundstück sei nur 11,4 m
entfernt von dem auf der anderen Straßenseite gelegenen Flügel des Ursulinenklosters, darin im
Erdgeschoß und im ersten Stockwerk die katholische „Volksmädchenschule“, im 2. Stockwerk der
Schlafsaal der als „Pensionärinnen“ bezeichneten Internatsschülerinnen sowie der Durchgang zur
höheren Töchterschule der Ursulinen. Ferner sei das Grundstück, und jetzt beginnt die Fortsetzung
des Zitats, „12,6 – 13,9 m von der mit dem Kloster in Verbindung stehenden, von der katholischen
Pfarrgemeinde mitbenutzten Liebfrauenkirche, 75,6 m von dem Grundstücke des Königlichen
Progymnasiums und 54 m von der in diesem Jahre zu erbauenden katholischen
Volksmädchenschule entfernt. Nach Vollendung derselben werden auch das Erdgeschoß und das I.
Stockwerk des bezeichneten Klosterflügels den Ursulinerinnen zur Einrichtung weiterer Schlafsäle
und eines Spielsaales überlassen werden. Das Ursulinerinnenkloster beherbergt zur Zeit 80
Pensionärinnen, die höhere Töchterschule derselben besuchen außerdem noch 30 Schülerinnen aus
der Stadt. Das Progymnasium wird von 83 Schülern, die Volksmädchenschule von 287
Schülerinnen besucht. Wegen solcher Nähe der Pensionärinnen und der drei Schulen eignet sich das
Grundstück unseres Erachtens nicht zum Bauplatz für eine weitere Schule.
Was aber den Bau einer Synagoge auf demselben anlangt, so ist der Ursulinerinnen-Convent von
der bezüglichen Anordnung unangenehm betroffen, und hat dieselbe in katholischen aber auch in
weiteren christlichen Kreisen hiesiger Stadt tiefgehende Erregung hervorgerufen, von der wir bei
Verwirklichung des Planes eine ernstliche Störung des jetzt guten Einvernehmens zwischen
Christen und Israeliten dahier befürchten. Wir verstehen das Empfinden des Ursulinerinnen-
Convents vollauf, meinen auch, dass demselben wegen seines segensreichen Wirkens und des aus
seinem Bestehen für die Stadt sich ergebenden großen Vorteils alle Rücksicht gebührt, und können
endlich der Erregung der Bürgerschaft Berechtigung nicht absprechen. Bei aller Duldsamkeit gegen
unsere jüdischen Mitbürger erscheint auch uns das Erbauen einer Synagoge unmittelbar neben einer
christlichen Kirche unpassend. Dazu kann beim unmittelbaren Nebeneinanderstehen der beiden
Gotteshäuser der Gottesdienst in dem einen sehr leicht den in dem anderen stören.
Ew. Hochwohlgeboren bitten wir hiernach ebenso ehrerbietig, wie dringend, der israelitischen
Gemeinde die Genehmigung zu dem vorgelegten Kaufvertrage bzw. zu dem Bau einer jüdischen
Synagoge auf dem in Rede stehenden Grundstücke versagen zu wollen. Die Möglichkeit der
Erwerbung anderer passender Bauplätze liegt vor.“ [17]
Dass für etwa 7 jüdische Kinder in der Straße kein Platz mehr sein sollte, wo schon hunderte andere
ihre Schulen besuchten, war ein mehr als fadenscheiniges Argument.
Der Brief des Bürgermeisters Machens macht ganz unverhohlen deutlich, dass die Duldsamkeit
gegenüber der jüdischen Minderheit in Duderstadt begrenzt war. Die Grenze schien dort
überschritten, wo die jüdische Gemeinde mit Selbstbewusstsein beanspruchte, gleichberechtigt
neben die christlichen Einwohner der Stadt zu treten und diesen Anspruch mit der Platzwahl für die
zu bauende Synagoge ausdrückte: nicht mehr, wie noch der jüdische Friedhof ganz abseits auf einer
feuchten Wiese, sondern im Zentrum der Stadt, wenn nicht beim Rathaus, dann in der Nähe vieler
Schulen und einer Kirche. Da dieser Anspruch als ernstliche Störung des angeblich guten
Einvernehmens zwischen Christen und Juden verstanden wurde, zeigt vor allem eins: Ein wirklich
gutes Miteinander gab es von Seiten derjenigen, die so dachten, nicht. Die rechtliche Gleichstellung
der Juden bedeutete eben noch längst nicht auch ihre gesellschaftliche Gleichstellung.
Auch der Bürgerverein beschäftigte sich mit der Standortfrage der Synagoge. Der „Platz“ so ist zu
zitieren, der „Platz der Liebfrauenkirche, dem Ursulinerinnen-Kloster, der katholischen höheren
Töchterschule und der katholischen Elementar-Mädchenschule gegenüber gelegen, wird als nicht
passend angesehen“ [18]. Allerdings ist demgegenüber festzuhalten, dass es auch andere gewichtige
Stimmen in Duderstadt gab. Die Königliche Landdrostei holte eine Stellungnahme des Landrats ein
und der erklärte,
„dass in den Kreisen, mit denen ich persönlich in Berührung komme, ich von der fraglichen
Erregung und Verstimmung nichts bemerkt habe. Da sie aber nach dem Bericht des Magistrats
dennoch besteht, so glaube ich annehmen zu dürfen, dass dies unter den Bewohnerinnen des
Klosters und den mit diesen Verkehrenden, vielleicht auch bei einem Theile der die Klosterkirche
benutzenden Katholiken der Fall sein wird. Ein besonderer Grund für diese Verstimmung ist mir
nicht bekannt; meines Erachtens wird sie lediglich als Gefühlssache zu beurtheilen sein.“ [19]
Die Bezirksregierung teilte die antisemitisch geprägten Ablehnungsgründe nicht und schob mit
Raffinesse dem Magistrat in Duderstadt die Lösung des von ihm gesehenen Problems wieder zu.
Sie räumte der Stadt die kurze Frist von 14 Tage ein, um in Verhandlungen mit dem Vorstand der
Synagogengemeinde die Verhinderung des Synagogen-Projekts in der Gartenstraße zu erreichen.
Der Magistrat legte der Synagogengemeinde den Kauf eines anderen Bauplatzes jedoch vergeblich
nahe. Daraufhin genehmigte die Bezirksregierung den Grundstückskauf „behufs demnächstiger
Erbauung einer Synagoge und Schule“ [20].
Am 24. August 1898 fand die Weihe der Synagoge statt. Das Duderstädter Wochenblatt „Zeitung
für’s Eichsfeld“ berichtete 2 Tage später über die Feierlichkeiten. Wir zitieren einige Ausschnitte
aus dem Artikel:
„Nachdem am Dienstag Abend der letzte Gottesdienst im alten Betsaal und darauf die
Ueberführung der heil[igen] Lade stattgefunden hatte, vollzog sich der Weiheakt Mittwoch
Vormittag unter Theilnahme des Königl. Landrats Herrn Geh. Regierungsraths v. Oven und des
hiesigen Magistrats in corpore, sowie von Gästen in folgender Ordnung: Nach Ueberreichung des
Schlüssels der neuen Synagoge erfolgte unter Vorangehen von blumenstreuenden kleinen Mädchen
der Einzug in dieselbe und vor die heil[ige] Lade. (…) Dann hielt der Landrabbiner Dr. Lewinsky
aus Hildesheim die Predigt und nahm hieran anschließend die Weihe der hei[igen] Lade, des
Betpultes, des ewigen Lichtes und der anderen den gottesdienstlichen Zwecken dienenden
Gegenstände, sowie des Hauses als Haus der Andacht vor. Mit dem Gebet für Kaiser und Reich, für
die hiesige Gemeinde und Stadt und mit Ertheilung des Segens schloß die gottesdienstliche
Handlung.
[…]
Nachmittags 3 Uhr begann im Saale des ‚Englischen Hofs’ das Festessen, an welchem weit über
100 Personen Theil nahmen, darunter die Stadtbehörde. (…) Es entwickelte sich bald die
gehobenste Stimmung, welche besonders auch durch die Tischreden zum Ausdruck kam. Nachdem
Herr M. Katz, welcher 25 Jahre lang Vorsteher der Synagogen-Gemeinde ist, die Gäste begrüßt
hatte, brachte Herr Landrabbiner Dr. Lewinsky den Trinkspruch aus Se. Majestät unseren
regierenden Kaiser Wilhelm II. aus. Herr Moritz Katz toastete auf den hiesigen Magistrat, Herr
Lehrer Speyer auf den Landrabbiner Dr. Lewinsky. Danach feierte Herr Bürgermeister Machens in
trefflichen Worten das gute Einvernehmen der den verschiedenen Konfessionen angehörenden
hiesigen Mitbürger. Der Landrabbiner Dr. Lewinsky trank auf das Wohl der Bürgerschaft der Stadt
Duderstadt. Es folgten noch Toaste auf den Vorsteher Katz, die Synagogen-Gemeinde Duderstadt
ec. Das Essen dehnte sich bis in die Abendstunden aus und konnte in Folge dessen der Ball erst
später beginnen wie im Programm vorgesehen war. Derselbe nahm, gleich dem Festessen einen
äußerst animirten Verlauf.“ [21]
Aus unserer heutigen Sicht erscheint das Gebet für Kaiser und Reich während des Gottesdienstes
auffällig. Dieses war allerdings vorgeschrieben. Es wurde jedoch ergänzt dadurch, dass der erste
Trinkspruch beim Festessen ebenfalls Wilhelm II. galt. Das dokumentiert nationales Denken und
Kaisertreue der jüdischen Gemeinde, also eine deutsch-jüdische Identität.
Die Teilnahme des Magistrats der Stadt und des Landrats drückte die Bedeutung, welche die Juden
in der Stadt erlangt hatten, aus. Sie waren nicht mehr eine Minderheit ganz am Rande. 1844 hatte
der Landrabbiner bemerkt, dass die Judenschaft in Duderstadt „viele arme Mitglieder in ihrer
Mitte“ [22] zählte. Seitdem hatten die Juden hier einen bemerkenswerten Aufstieg erreicht. Der Bau
einer ansehnlichen Synagoge an einem unübersehbaren Ort drückte sowohl den insgesamt
erreichten Wohlstand wie auch das gewonnene Selbstbewusstsein aus. Ob die Unwahrhaftigkeit des
Bürgermeisters Machens, der den Bau der Synagoge in der Gartenstraße im Sinne der Ursulinen
und anderer hatte verhindern wollen und nun das gute Einvernehmen aller feierte, in der Euphorie
des Festes überhaupt bemerkt wurde, lässt sich nicht sagen. Dabei fällt jedoch in diesem
Zusammenhang auf, dass Vertreter der christlichen Kirchengemeinden in dem Zeitungsartikel über
die Einweihungsfeierlichkeiten als Teilnehmer nicht erwähnt werden, also wohl auch nicht
teilgenommen haben.
Die Jahre um 1900 waren die Blütezeit der jüdischen Gemeinde Duderstadt mit bis zu 85
Mitgliedern. 1903 betrug die Zahl der jüdischen Haushalte hier 22. Die Berufsstruktur der
Duderstädter Juden war immer noch geprägt durch die früher geltenden Betätigungsverbote in
vielen Geschäftsbereichen. Jüdische Bauern oder Häusler gab es 1903 hier nicht, auch keine
Handwerker, aber 11 Kaufleute.
Auch in Duderstadt machte sich die zu Anfang des Jahrhunderts im gesamten Deutschen Reich
beginnende Abwanderung zahlreicher Juden vom Land und aus Kleinstädten in mittlere und größere
Städte bemerkbar. Das wirkte sich auf die Synagogengemeinde aus. 1932 gab deren Vorsteher, der
Kaufmann Gustav Löwenthal an, dass die hiesige Synagogengemeinde keinen eigenen Rabbiner
besitze und auch kein fremder Rabbiner die Seelsorge in der Gemeinde ausübe. Sie seien schon seit
langen Jahren ohne Seelsorger, da sie wegen der geringen zahl der Mitglieder die kosten nicht
tragen könnten.“ Zu Beginn des Jahres 1933 lebten nach einer Aufstellung des Duderstädter
Standesamtes aus dem Jahr 1981 noch 33 Juden in Duderstadt.
Schlussbemerkungen
Bei der Betrachtung der Geschichte der Juden von 1812 bis 1932, so möchte ich abschließend
bemerken, stellt sich als eine wichtige Frage die nach dem Verhältnis zwischen Juden und sonstigen
Einwohnern. In den untersuchten Akten findet sich wenig über dass alltägliche, gar private
Zusammenleben von Juden und Christen. Auf Ehen zwischen Juden und Christen bin ich bislang
nicht gestoßen. Ob Juden in Duderstadt Vereinen beitreten durften und dies taten, ist nicht bekannt.
Ob sie in kommunalen Gremien mitwirken konnten, wurde bislang nicht untersucht. Vieles bleibt
also offen. Die geschäftlichen Beziehungen zwischen jüdischen Kaufleuten und christlichen
Einwohnern müssen allerdings gut gewesen sein, denn andernfalls wäre der wirtschaftliche Erfolg
nicht möglich gewesen.
In den Akten der Archive ist selten Unterstützung der jüdischen Einwohner festzustellen.
Bürgermeister Jordan hat den Antrag auf Einbürgerung des Simon Levy unterstützt; der Landrat
teilte nicht die Einwände gegen den Bau der Synagoge in der Gartenstraße. Auf der anderen Seite
sind viele Beispiele eines krassen Antisemitismus festzustellen. Ich erinnere an die Versuche, eine
Ansiedlung von Juden in Duderstadt zu verhindern bzw. ihre Ausweisung zu betreiben; die
einstimmige, rechtswidrige Verweigerung des Bürgerrechts für Levy durch das Bürgervorsteher-
Kollegium; die Zuweisung eines unwürdigen Begräbnisplatzes; die fehlende Neigung, jüdische
Kinder in christlich-konfessionellen Schulen aufzunehmen; die Ablehnung des Baus der Synagoge
und noch einiges mehr. Das alles berechtigt nicht dazu, was aber geschieht, von einem früher guten
Verhältnis zwischen den Mitbürgern verschiedener Konfessionen zu sprechen. Ein derartiges
Verhältnis gab es hier noch nicht einmal zwischen den christlichen Konfessionen.
Die Verdrängung dessen, dass es einen starken Antisemitismus in Duderstadt gab, trägt sogleich zur
nächsten Selbsttäuschung bei. Sie erschwert nämlich die Erkenntnis, dass die traditionelle
Judenfeindlichkeit zwar vom rassistischen Antisemitismus der Nazis zu unterscheiden ist, diesem
aber Wege geebnet hat – auch in Duderstadt. Damit aber sind wir dabei, die Schwelle zum Jahr
1933 zu überschreiten. Die Zeit von 1933 an soll jedoch Thema eines 2. Vortrages am 20. Januar an
diesem Ort sein, also wieder in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Göttingen. Das
Thema wird lauten: Untergang und Nachgeschichte der Synagogengemeinde Duderstadt 1933 bis
1988. Dazu laden wir Sie jetzt schon ein. Für heute danken wir für Ihre Aufmerksamkeit und bieten
an, über das Thema des heutigen Abends noch miteinander zu sprechen.
Fussnoten:
1.
StadtA Duderstadt: Dud2 Nr. 22608 [zurück zum Text]
2.
A.a.O. [zurück zum Text]
3.
A.a.O. [zurück zum Text]
4.
A.a.O. [zurück zum Text]
5.
StadtA Duderstadt: Dud2 Nr. 22582 [zurück zum Text]
6.
StadtA Duderstadt: Dud2 Nr. 2362. [zurück zum Text]
7.
A.a.O. [zurück zum Text]
8.
A.a.O. [zurück zum Text]
9.
StadtA. Duderstadt: Dud2 Nr. 22622. [zurück zum Text]
10.
A.a.O. [zurück zum Text]
11.
A.a.O. [zurück zum Text]
12.
Stadtarchiv Duderstadt: Dud2 Nr. 22624. [zurück zum Text]
13.
StadtA Duderstadt: Dud2 Nr. 22627. [zurück zum Text]
14.
Die Jahresangabe am Haus weicht von den dazu vorhandenen Dokumenten ab! [zurück
zum Text]
15.
HStA Hannover: Hann 180 Hildesheim Nr. 3960. [zurück zum Text]
16.
StadtA Duderstadt: Dud2 Nr. 2375. [zurück zum Text]
17.
StadtA Duderstadt: Dud2 Nr. 2375. [zurück zum Text]
18.
HStA Hannover: Hann. 180 Hildesheim Nr. 3960. [zurück zum Text]
19.
A.a.O. [zurück zum Text]
20.
StadtA Duderstadt: Dud2 Nr. 2375. [zurück zum Text]
21.
Zeitung für’s Eichsfeld vom 26.8.1898: Die Einweihung der Synagoge zu Duderstadt.
[zurück zum Text]
22.
StadtA Duderstadt: Dud2 Nr. 22600. [zurück zum Text]

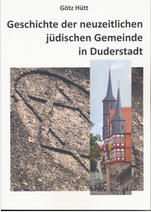
Die Geschichte der
jüdischen Gemein-
de in Duderstadt
1812-1942 und ihre
Nachgeschichte,
2012, 184 S., 14 €
Literatur:
Themen:
NS-Zwangsarbeit
- Zwangsarbeiterkind
in Duderstadt
KZ-Außenlager
Jüdische Gemeinde:
- Geschichte
- jüdischer Friedhof
- Friedhof 1953
- Vernichtung
- Stolpersteine
Nationalsozialismus
und Duderstadt
- Verdrängte Realität
- Bgm. Dornieden
- Richter Trümper
- Priester R. Kleine
Nachgeschichte des
Nationalsozialismus:
- bürgerliche Alt-Nazis
- Kriegsgräber
- Anreischke
- Rechtsextremismus
Friedensglobus
Kriegsgefangene
Hinweis:
Die
Geschichtswerkstatt
Duderstadt e.V.
wurde vom
Finanzamt Northeim
als gemeinnützig
anerkannt und kann
Spendenquittungen
ausstellen.
Bankverbindung der
Geschichtswerkstatt:
Sparkasse
Duderstadt (BLZ
26051260), Konto
Nummer 116830

















