



Das Außenlager Duderstadt des KZ Buchenwald
Mit der noch unbestimmten Bezeichnung „Duderstadt bei Göttingen“
wurde das Frauen-Außenlager Duderstadt des KZ Buchenwald im
Anhang zu Dokument F 321 im Hauptkriegsverbrecherprozess 1945/46
vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg erwähnt. Durch
dieses KZ-Lager ist das Polte-Gelände am Euzenberg einbezogen in
das furchtbarste Kapitel deutscher Geschichte – die planmäßige
Vernichtung der europäischen Juden.
Auf dem 2. Foto von links der Bilderleiste oben: Das KZ-Lager drei Tage
nach der Evakuierung und einen Tag nach der Besetzung durch
amerikanische Truppen – am 10.4.1945. Im Hintergrund Gebäude des
Polte-Werks. Quelle: IWM London.
Die Errichtung des Polte-Werks
Zunächst hatte in der zweiten Hälfte der 30er Jahre des letzten
Jahrhunderts die Bebauung der landwirtschaftlich genutzten Flächen
unterhalb des Euzenbergs harmlos, geradezu vernünftig begonnen. Um
Arbeitslosigkeit und Armut in Duderstadt zu bekämpfen, hatte sich
Bürgermeister Dornieden ehrgeizige Ziele gesetzt: die Ansiedlung von
Industrie. Seit 1935 ließ er Ackerland für ein Industriegebiet erwerben.
1937 wurde zu dessen Erschließung die Industriestraße gebaut. Als
erstes Gebäude an dieser Straße entstand die Möbel- und Polsterfabrik
Steinhoff (heute: Dachdeckerbetrieb Koch). Das Gebäude wurde jedoch
nach seiner Fertigstellung sogleich für das nächste, nunmehr dem
verbrecherischen Handeln des NS-Staats dienenden Industrie-Projekt
als Unterkunft benötigt. Von Oktober 1939 an errichtete der
Magdeburger Rüstungsbetrieb Polte im Auftrag des
Reichsluftfahrtministeriums in Duderstadt auf dem dafür um 45 Hektar
vergrößerten Industriegebiet eine Fabrik für Flugabwehrgranaten. Weil
aber viele Eichsfelder Männer inzwischen als Soldaten Dienst taten,
mussten Bauarbeiter aus anderen Regionen nach Duderstadt geholt
werden, unter ihnen angeworbene Fremdarbeiter sowie Zwangsarbeiter
aus vielen Ländern Europas.
Aus Sicherheitsgründen wurde die Produktionsanlage des Polte-Werks
in drei voneinander getrennte Bereiche gegliedert. Im nordöstlichen
Abschnitt – jetzt Industriepark - wurden die Geschosse, Zünder und
Hülsen gefertigt. In dem heute von der Bundespolizei genutzten
mittleren und im südwestlichen Bereich wurden die Geschosse mit
Sprengstoff befüllt und die Granaten zusammengesetzt bzw. der
Sprengstoff und die fertige Munition gelagert.
Arbeitskräfte im Polte-Werk
Die Produktion begann in der 2. Hälfte des Jahres 1941. Die
Beschaffung der dafür erforderlichen Arbeitskräfte gestaltete sich
schwierig. Viele Frauen aus Duderstadt und seiner Umgebung wurden
zur Arbeit im Polte-Werk dienstverpflichtet. Überdies musste eine große
Zahl von Männern und Frauen aus dem Ausland als Arbeitskräfte
eingesetzt werden – angeworbene Zivilarbeiter, Kriegsgefangene,
Zwangsarbeiter und schließlich auch KZ-Häftlinge. Bis Januar 1944
stieg die Zahl der Beschäftigten auf 2487 an.
Die Ausländer wurden zum Teil auf dem Steinhoff-Gelände
untergebracht, wo zusätzlich drei Baracken aufgestellt waren, und in
einer weiteren Barackensiedlung unmittelbar vor dem Eingang zum
Fabrikgelände. Dieses „Euzenberg-Lager Polte“, bereits für die
Bauarbeiter errichtet, wurde später auf einen Duderstädter Fußballplatz
verlegt.
Der nationalsozialistischen Rassenideologie entsprechend wurden die
ausländischen Arbeitskräfte unterschiedlich behandelt. Männer und
Frauen aus westeuropäischen Ländern erhielten beispielsweise einen
höheren Lohn ausbezahlt und – für das Überleben wichtig - besseres
Essen zugeteilt als die aus dem Osten nach Duderstadt verschleppten
Menschen. Zu den Lebensbedingungen der ausländischen
Zwangsarbeitenden hat die ehemalige Abwehrchefin des Polte-Werks
folgende Aussage gemacht:
„Tagtäglich erhielten die Fremdarbeiter nur eine undefinierbare Suppe,
so daß sich einige von ihnen vor Hunger heimlich rohe Kartoffelschalen
oder andere Essensreste aus der Mülltonne geholt haben. Die Arbeiter
wurden bis an ihre Existenzgrenze ausgebeutet. So kam es öfter vor,
daß einige von ihnen bei der Arbeit vor Übermüdung einschliefen. Wenn
ein Fall wie der zweier Fremdarbeiter, die an der Röstungsanlage für
Nitropenta eingeschlafen waren, der Sicherheitsabteilung des Werkes
gemeldet wurde, begann ein langwieriges Verhör, welches früh morgens
begann und erst gegen Mitternacht beendet wurde. Zuerst begann das
Verhör ganz freundlich, den Fremdarbeitern wurden Zigaretten und
Kaffee angeboten, mit der Zeit wurde dies jedoch immer aggressiver, so
dass viele von ihnen geschlagen und gefoltert wurden. Nach dem Verhör
brachte die Gestapo die Fremdarbeiter wegen ‚Zersetzung der
Wehrkraft’ nach Göttingen. Über das weitere Schicksal dieser Arbeiter
lässt sich nichts sagen, sie sind nie wieder nach Duderstadt
zurückgekehrt.“
Die Einrichtung eines Außenlagers des KZ Buchenwald
Auf der untersten Stufe der nationalsozialistischen Rassenskala aber
standen die jüdischen KZ-Häftlinge im Polte-Werk. Es waren junge
Mädchen und Frauen aus Ungarn. 1944, nach der Besetzung Ungarns
durch die Wehrmacht, waren sie als Juden zunächst entrechtet, ihrer
wirtschaftlichen Lebensgrundlage beraubt, dann in Ghettos
zusammengepfercht und schließlich nach Auschwitz deportiert worden.
Dort entgingen sie der Ermordung in den Gaskammern, weil sie bei den
Selektionen als arbeitsfähig eingestuft wurden. Von Auschwitz
transportierte die SS die Frauen in das Konzentrationslager Bergen-
Belsen. Nach Duderstadt gelangten sie auf Veranlassung der Polte-
Hauptverwaltung in Magdeburg. Die Firmenleitung hatte bei der SS die
Zuweisung von KZ-Häftlingen für das Werk Duderstadt beantragt.
Angehörige der Firma Polte suchten 750 für Duderstadt bestimmte
Frauen in Bergen-Belsen persönlich aus. Wahrscheinlich am 4.11.1944
trafen die Gefangenen in Güterwaggons in Duderstadt ein und wurden
auf dem Steinhoff-Gelände untergebracht.
Die SS hatte eine strenge Sicherung dieses Lagers verlangt. So stellte
das Polte-Werk Duderstadt im Oktober 1944 einen Bauantrag für die
Errichtung eines Lagerzauns und dokumentierte auch dadurch den
damaligen Rassenwahn: 2,50 Meter hoch sollte der Zaun sein und auf
der Innenseite bis oben hin mit Stacheldraht und elektrisch geladenen
Drähten versehen werden; nach außen eine Verbretterung, zwei Meter
hoch und an den Straßenseiten lückenlos als „verstärkter Zaun“ das
Lager vor Blicken abschirmend; zum Lager hin, und zwar in einem
Abstand von einem Meter, ein weiterer „Schutzzaun“, 1,5 m hoch, aus
Holzpfosten und Stacheldraht. Ob dieser insgesamt als „Einfriedung“
bezeichnete Zaun wirklich so gebaut wurde, ist nicht belegt. - Die
Unterkunft der Wachmannschaften, SS-Leute und SS-Aufseherinnen,
befand sich im Hauptgebäude der Möbelfabrik. Die Aufseherinnen waren
aus der Belegschaft des Polte-Werks dienstverpflichtet und zwei
Wochen im Konzentrationslager Ravensbrück ausgebildet worden.
Verwaltet wurde dieses KZ als Außenlager des Konzentrationslagers
Buchenwald. Es diente finanziell dem Vorteil des Polte-Werks wie der
SS. Dem Polte-Werk standen billige Arbeitskräfte zur Verfügung. Vier
Reichsmark mussten pro Arbeitstag eines Häftlings gezahlt werden – an
die SS. Die Gefangenen selbst erhielten davon nichts. Sie waren gegen
Entgelt verliehene Arbeitssklaven.
Lange Arbeitszeiten in wöchentlich wechselnder Tag- und Nachtschicht,
ungenügende Bekleidung, mangelhafte medizinische Versorgung und
Hunger infolge unzureichender Ernährung kennzeichneten die
Lebensbedingungen der gefangenen Frauen im KZ-Außenlager
Duderstadt. Diese Umstände entsprachen in etwa den Bedingungen für
KZ-Häftlinge in der Rüstungsindustrie allgemein; die
Überlebenschancen waren weitaus günstiger als beispielsweise in den
Baukommandos. In den fünf Monaten, die das KZ-Außenlager
Duderstadt bestand, starben vier der jungen Frauen, ebenso ein im
Januar 1945 im Lager geborenes Kind. Eine Schwangere wurde nach
Bergen-Belsen zurückgebracht. Um den Vertrag mit dem Polte-Werk
über die Gestellung von 750 Häftlingen zu erfüllen, brachte die SS am
28. Januar 1945 weitere fünf Ungarinnen als Ersatz für die Ausfälle aus
Bergen-Belsen nach Duderstadt.
Erinnerungen einer früheren Gefangenen
Einen Eindruck vom Schicksal dieser jüdischen Ungarinnen als Häftlinge
der SS und Arbeiterinnen im Polte-Werk Duderstadt sowie von
lebenslangen Folgen solcher Gefangenschaft können Gedanken und
Erinnerungen vermitteln, die Frau V. R. im März 2005 in Szeged/Ungarn
in einem Brief niederschrieb. Mit ihrem Mädchennamen hieß die
Verfasserin Maria Schwarz. Sie war fast noch ein Kind und Häftling Nr.
42628 des Lagersystems von Buchenwald, als sie 1944/45 in
Duderstadt Zwangsarbeit leisten musste. In dem Brief in der
Übersetzung von Szusanna Pavelka heißt es:
„Das andere ist, dass ich immer noch nicht verarbeiten konnte, was ich
mit 14 Jahren unschuldig durchmachen musste …(Ich kann) erzählen,
dass man mich – obwohl ich eine gute Schülerin war – wegen diverser
Judengesetze gar nicht mehr am Gymnasium aufgenommen hat; mit
gelbem Stern gekennzeichnet zwang man mich ins Ghetto. Dann
pferchten sie 80 Menschen, von all ihrem Hab und Gut getrennt, in einen
Viehwaggon und deportierten uns nach Auschwitz, wo sie 22 meiner
Familienmitglieder in die Gaskammer brachten und danach verbrannten,
zusammen mit meinen jüdischen Klassenkameradinnen.
Von dort kam ich nach Bergen-Belsen, dann nach Duderstadt. In Halle
17 arbeitete ich abwechselnd die eine Woche von 6 Uhr morgens bis 6
Uhr abends, die andere Woche von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. In
Schnee und Eis gingen wir den weiten Weg zur Fabrik, barfuß in
Holzschuhen und ohne Unterwäsche in einer gestreiften
Häftlingsuniform. Die Aufseherinnen begleiteten uns mit Schäferhunden,
die darauf abgerichtet waren, jeden, der in der Fünferreihe nicht gerade
ging, anzufallen. Es kam vor, dass uns im Schnee die Schuhe von den
Füßen fielen, da unsere gefrorenen Füße sie nicht spürten; die nach uns
kommenden Gefangenen fragten, wem die ‚Schuhe’ fehlten und gaben
sie dann zurück.
In der Fabrik musste ich alleine an einer großen Maschine im
Kriegsdienst Patronenhülsen formen. Die kleineren Patronen waren in
Lauge eingelegt und ich musste sie ohne Handschuhe aus der Lauge in
die Maschine legen. Beim Hineinlegen der Hülsen in die Maschine
wurden meine Fingernägel völlig abgewetzt. Das kleine bisschen
ranzige Margarine (ca. 20 g) konnte ich nicht essen, da ich sie auf meine
von der Lauge zerfressenen Hände schmieren musste, so weh tat es.
Sonntags gruben wir Rüben aus, und wenn wir es, vom Hunger gequält,
wagten, von den dreckigen, matschigen Rüben zu essen und die
Aufsicht das bemerkte, so schoren sie uns unser bereits geschorenes,
aber auf 1 – 2 cm gewachsenes Haar erneut ab oder ließen uns mit
Ziegelsteinen in der Hand stundenlang auf dem Appellplatz knien. Es tat
uns nicht um unsere Haare leid, sondern kahlgeschoren froren unsere
Köpfe im Winter sehr.
Da es eine Rüstungsfabrik war und die Russen näher kamen, setzten
sie uns erneut in Waggons und brachten uns weg …
An dieser Stelle muss das Zitat aus dem Brief für eine Anmerkung
unterbrochen werden. Wir wissen, nicht die Russen, sondern die
Amerikaner rückten im April 1945 auf Duderstadt vor. Aber man sollte
sich die Situation der Häftlinge damals vergegenwärtigen. Sie waren von
Informationen über das Kriegsgeschehen weitgehend abgeschnitten.
Über Radio oder Zeitung verfügten sie nicht, Kontakte zu anderen
Angehörigen des Polte-Werks waren ihnen über die Arbeitserfordernisse
hinaus verboten und somit nur begrenzt möglich. Bei ihrem Abtransport
aus Duderstadt, wahrscheinlich am 7. April 1945, hörten die Häftlinge
bereits Kanonendonner und sahen die weißen Fahnen der Kapitulation
auf den Dächern der Häuser. Sie bekamen aber die Truppen, die dann
am 9. April 1945 in Duderstadt einrückten, nicht mehr zu Gesicht. Ihre
SS-Bewacher führten sie zwischen den von Osten und Westen her
zusammenrückenden Fronten der Alliierten hindurch in dreiwöchiger
Irrfahrt nach Theresienstadt, einmal den Amerikanern, dann wieder den
Russen näher. Der Irrtum der Verfasserin über die Befreier Duderstadts
von der Macht des Nationalsozialismus schmälert daher nicht die
Authentizität ihres Berichts über das, was sie selbst erlebt hat. In ihrem
Brief heißt es dazu weiter:
“... doch an einem Bahnhof wurde der Zug von einer Bombe getroffen.
Ein Splitter erreichte den Waggon, in dem ich war. Neben mir starben
zwei Mithäftlinge, ich wurde von dem Luftdruck [gemeint ist wohl die
Druckwelle, Z.P.] taub. Sie trieben uns zu Fuß weiter. Zu essen bekamen
wir fast nichts, eine dünne Scheibe Brot aus Kleie für drei Häftlinge, und
wenn wir es wagten, uns vor Hunger nach Gras oder Brennnesseln zu
bücken, schossen sie auf uns! Wir waren verlaust und hatten Krätze, als
wir nach Theresienstadt gelangten, dort dezimierte uns der Flecktyphus.
Die, die am Leben blieben, wurden von den Russen befreit. Ich wog 29
kg, als wir nach Hause kamen. Ich bin 75 Jahre alt und ein
Menschenfreund, aber was sie mit uns gemacht haben, das KANN MAN
NICHT vergessen. Aus meiner verschleppten Familie kam keiner zurück.
Ein Bruder kam zurück, der Zwangsarbeiter war und Mauthausen
überlebte …
Ich habe einen 50-jährigen Sohn, er ist Arzt, und zwei Enkelkinder in
Amerika, und das einzige, was mir noch Hoffnung gibt, ist, dass sie nicht
mehr verfolgt werden, weil sie Juden sind.“
Maria Schwarz hat entgegen den Absichten überlebt, welche die SS mit
den jüdischen Häftlingen verfolgte. Diese sollten bis zur vollständigen
Erschöpfung ihrer Arbeits- und Lebenskraft genutzt werden.
„Vernichtung durch Arbeit“ hieß das in der Sprache der Nazis. Doch die
Vernichtung vereitelten im Fall der in Duderstadt inhaftierten
Ungarinnen, jedenfalls für die weitaus meisten von ihnen, 1945 die
Truppen der Siegermächte.
(Götz Hütt)
Herangezogene Literatur:
Baranowski, Frank: Geheime Rüstungsprojekte in Südniedersachsen
und Thüringen während der NS-Zeit. Duderstadt 1995.
Ebeling, Hans-Heinrich / Fricke, Hans-Reinhard: Duderstadt 1929 –
1949. Untersuchungen zur Stadtgeschichte im Zeitalter des Dritten
Reichs. Vom Ende der Weimarer Republik bis zur Gründung der
Bundesrepublik Deutschland. Duderstadt 1992.
Hütt, Götz: Das Außenkommando des KZ Buchenwald in Duderstadt.
Ungarische Jüdinnen im Rüstungsbetrieb Polte. Norderstedt 2005.
Siedbürger, Günther: Zwangsarbeit im Landkreis Göttingen 1939-1945.
Duderstadt 2005
Literatur:
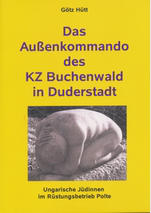
Die Geschichte und
Nachgeschichte des
Außenlagers von
Buchenwald in
Duderstadt, 2005,
132 S., 8,90 €

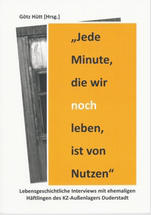
Lebensgeschichtliche
Interviews mit ehe-
maligen Häftlingen
des KZ-Außenlagers
Duderstadt, 2011,
132 S., 12 €
Themen:
NS-Zwangsarbeit
- Zwangsarbeiterkind
in Duderstadt
KZ-Außenlager
Jüdische Gemeinde:
- Geschichte
- jüdischer Friedhof
- Friedhof 1953
- Vernichtung
- Stolpersteine
Nationalsozialismus
und Duderstadt
- Verdrängte Realität
- Bgm. Dornieden
- Richter Trümper
- Priester R. Kleine
Nachgeschichte des
Nationalsozialismus:
- bürgerliche Alt-Nazis
- Kriegsgräber
- Anreischke
- Rechtsextremismus
Friedensglobus
Kriegsgefangene
Hinweis:
Die
Geschichtswerkstatt
Duderstadt e.V.
wurde vom
Finanzamt Northeim
als gemeinnützig
anerkannt und kann
Spendenquittungen
ausstellen.
Bankverbindung der
Geschichtswerkstatt:
Sparkasse
Duderstadt (BLZ
26051260), Konto
Nummer 116830

















